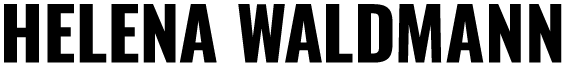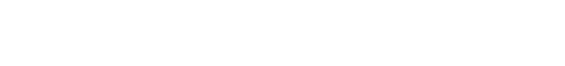get a revolver
Revolver besorgen
In get a revolver, Waldmann investigates forgetting as a positive and liberating potential of the human brain, sensing the capacity for happiness contained there. With the superb dancer Brit Rodemund, she has achieved a grotesque as well as humorous work “that reflects on restraints, and the temptation to break away from these, using ballet as a symbol of the rigorous training that life demands of us. During the 60 minutes of the performance, Brit Rodemund becomes her own twin: a classical ballerina with dazzling presence, then a searcher, for whom everything, even her own body or a plastic bag, is a source of wonder. She impressively shows the balancing act between a thirst for discovery and the depths of madness. Even in difficult moments, she gives her character the dignity a person needs to remain human. Despite the knowledge that a revolver might entail a departure from a world that she no longer understands, she is still able to laugh – about the possibility of liberation contained in forgetting. Is one then really lost to the world when memory is no longer linked to the world’s demands?
Brit Rodemund was awarded „dancer of the year 2011“ in this performance and with 49 shows, in 9 countries, on 3 continents this production achieved worldwide fame.
a production by Helena Waldmann and ecotopia dance productions
In coproduction with Dance 2010 München (D), Festspiele Ludwigshafen im Theater im Pfalzbau (D), Forum Freies Theater Düsseldorf (D), Hellerau – europäisches Zentrum der Künste Dresden (D), O Espaço do tempo Montemor-o-Novo (PL), Théâtres de la ville de Luxembourg (L)
Official Trailer – get a revolver | 5 min.
Trailer – Theaterfestival Basel | 2:00 min.
TV 3 Sat Foyer: featuring get a revolver | 5:45 min.
Official full length video – get a revolver | 60 min. | only with password, ask me
2010
stage design
direction
choreography
Helena Waldmann
dance
Brit Rodemund
music
Gustav Mahler
Johann Strauss
Zeitkratzer
Nat King Cole
light design
Herbert Cybulska
costume
Mari Krautschick
dramaturgy
Dunja Funke
choreographic collaboration
Tim Plegge
sound editing
Tito Toblerone
radiofeature
Helena Waldmann
Dunja Funke
voices in the feature
Nina de Vries (Sexualassistentin, Berlin)
Prof. Dr. Em. Reimer Gronemeyer (Autor und Soziologe, 1. Vorsitzender Aktion Demenz, Universität Gießen)
Prof. Dr. med. Franz Heppner (Leiter des Instituts für Neuropathologie an der Charité, Berlin)
Uta Stöcking (Sprecherin, Berlin)
assistant light
Yvonne Standke
technical staff
Carsten Wank
Stephan Wöhrmann
project management
Claudia Bauer
fotos
Sebastian Bolesch
duration
60 minutes
Touring
2010
2011
FEBR 9
Tafelhalle im KunstKulturQuartier Nürnberg (D)
APRIL 21-23
Radialsystem V Berlin (D)
APRIL 29-30
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden (D)
MAY 4
Tollhaus Karlsruhe (D)
MAY 6
Theaterhaus Stuttgart (D)
MAY 27-28
Forum Freies Theater in Cooperation with Tanzhaus NRW Düsseldorf (D)
NOV 24-25
Theater im Pfalzbau Ludwigshafen (D)
2012
FEBR 3
Grand Théâtre Luxembourg (L)
FEBR 24-25
Tanzplattform 2012 Dresden,Staatsschauspiel Dresden (D)
MARCH 13
Posthof Linz (A)
MARCH 21
TANZ Bremen (D)
MARCH 23-24
Pumpenhaus Münster (D)
MARCH 29
Burghof Lörrach (D)
MAY 19
Sommerblut Kulturfestival Köln (D)
JUNE 26
Rheinfall Festival Schaffhausen (CH)
JULY 12-13
Julidanse Amsterdam (NL)
SEPT 4-5
Tanzfestival Basel (CH)
SEPT 21-22
Body/Mind Festival Warswa Poland (POL)
SEPT 28-29
Europe meets Vietnam in Dance Festival Hanoi, Vietnam
OKT 6-7
Performing Arts Festival Seoul, Korea
OKT 25
Radialsystem Berlin (D)
NOV 21
Tanzfestival Jena (D)
2013
MAY 7
Theater Baden (CH)
JULY 4
Festival Ulm Moves, Roxy Ulm (D)
JULY 30
Tanzfestival Bielefeld (D)
2014
FEBR 7-8
National Arts Center Ottawa, Kanada
FEBR 11-15
Festival Danse Danse Montreal, Kanada
JULY 14
International Theatre Festival Zero Point Prague (CZ)
Conversations
german
Berliner Zeitung | 19.4.2011
Michaela Schlagenwerth im Gespräch mit Helena Waldmann
In einem Moment Hamlet, im nächsten Ophelia. Helena Waldmann hat ein Tanzstück über Demenz inszeniert. Ein Gespräch über die Erfahrungen mit ihrem Vater >
Der Vater der Choreografin Helena Waldmann war acht Jahre lang an Demenz erkrankt. Nach seinem Tod im letzten Jahr hat Waldmann ihre Erfahrung zu einem Solo für die Balletttänzerin Brit Rodemund verarbeitet. In dem Stück „Revolver besorgen“ kommen aus dem Off Wissenschaftler zu Wort und eine älter werdende Tänzerin laviert an den Grenzen ihres früheren Könnens. Auch Erinnerungen an den Vater und die Menschen im Heim sind eingeflossen.
Frau Waldmann, „Revolver besorgen“, das klingt ein wenig bedrohlich. Was hat es mit dem Titel Ihres Stücks auf sich?
Der Titel soll nicht Angst machen, im Gegenteil. Ich finde, dass diese Krankheit zu einem Schreckgespenst gemacht wird. Die Menschen bekommen solche Angst, dass viele sagen, sie würden lieber sterben als dement sein. So sehr fürchten sie sich davor, diesen Ich-Verlust zu erleiden und orientierungslos in dieser Welt herum zu geistern. Ich habe mit meinem Vater aber auch sehr Positives erlebt. Die schlechte Seite ist ja weit genug verbreitet. Ich frage eher, was eigentlich das Gute ist.
Und was ist oder was könnte das Gute daran sein?
Die Kommunikation verändert sich, die Worte brechen weg, es findet eine ganz starke Entortung statt. Wo ist man eigentlich? Natürlich hat das mit einer großen Hilflosigkeit zu tun, aber die Wahrnehmung verschiebt sich. Das, was vorher über Kommunikation gelaufen ist, passiert auf einmal auf andere Weise, durch Berührung oder man spricht mit den Augen. Man fängt auf einmal an, Dinge in einem Menschen zu lesen, wo das vorher überhaupt nicht nötig war. Aber man muss bereit sein, das neu zu lernen.
Wusste Ihr Vater noch, wer Sie waren?
Nein, irgendwann nicht mehr. Das war sehr schmerzhaft und ich habe dann einen Trick angewandt. Ich habe, wenn ich kam, als erstes gesagt: „Ich bin’s, deine Tochter.“ Sonst, wenn ich gekommen bin, hat er mich oft angeguckt und gefragt: „Wer sind Sie?“ Aber mit der Hilfe hat es ganz gut funktioniert. Irgendwann hat mein Vater gefragt: „Bin ich dein Vater?“ Das fand ich richtig gut.
War das nicht sehr traurig für Sie?
Natürlich war es das. Ich will auch die Demenz nicht verharmlosen, in meinem Stück denkt man nicht, das wäre etwas Tolles. Die Leute haben beim Rausgehen eher einen Kloß im Hals. Aber ich finde, es kommen in dieser Krankheit auch Dinge wieder zu Tage, als wäre jemand nicht durch das Nadelöhr der Erziehung gedrückt worden. Kinder kommen so frisch und unverbraucht auf die Welt und dann ziehen wir sie wie durch dieses Nadelöhr. Bei meinem Vater hatte ich das Gefühl, dieser alte Mann zieht sich wieder auf die andere Seite zurück. Jeder Mensch trägt eine Sorge um sich mit sich. Aber was passiert eigentlich, wenn diese Sorge wegfällt? Darin liegt auch etwas Befreiendes.
Aber ist es nicht eher so, dass Menschen, die an Demenz erkranken, oft vor Angst erstarren? Vor allem, wenn sie merken, sie haben etwas falsch gemacht und sie haben nicht einmal eine Ahnung, was es sein könnte. Das erleben viele als sehr bedrohlich.
Der Soziologe Reimer Heppner unterteilt den Krankheitsverlauf in drei Phasen. Die erste ist die Schlimmste. Wenn man merkt, wie das Gegenüber komisch reagiert, in der zweiten Phase ist das fast weg, in der dritten Phase dann ganz. Die Behauptung ist, und so habe ich es bei meinem Vater auch erlebt, je weiter die Demenz fortgeschritten ist, umso freier leben sie. Die Angst ist weg.
Oft switchen Menschen mit Demenz aber jahrelang zwischen den Momenten, in denen sie quasi noch „die Alten“ sind und denen des Vergessens.
Menschen, die mit Theater, mit Rollenspiel zu tun haben, kennen das. In dem einen Moment bist du Hamlet, im nächsten Ophelia. Ich glaube, dass es Menschen mit Demenz wahnsinnig hilft, wenn man das nicht als falsch, sondern als eine andere Rolle betrachtet. Es gibt hier in Berlin eine Schauspielerin, Anina Michalski, die früher auch bei Peter Zadek gespielt hat. Als ihre Mutter an Demenz erkrankte hat sie sich um sie gekümmert und dabei gemerkt, dass ihr diese Arbeit so einen Spaß macht, dass sie jetzt Menschen mit Demenz betreut. Sie vermittelt den Leuten, dass es nicht falsch ist, was sie tun. Sie kriegen keine Angst, sie können in ihrem Gesicht lesen, dass sie jetzt keinen Fehler, sondern dass sie etwas jetzt einfach nur anders gemacht haben.
Vielen Menschen fällt das schwer. Gerade die nächsten Verwandten erleben das als Entgleisung, als etwas Unheimliches.
Das war in meiner Familie auch so. Es gab auch die, die sich sehr für meinen Vater geschämt haben. Mein Vater war Doktor der Chemie, ein sehr wortgewandter, klug denkender Mensch und auf einmal hat er sich unglaubliche Freiheiten herausgenommen. Er hat kein Blatt mehr vor dem Mund genommen, alles kam immer sofort im Moment heraus. Das habe ich oft in dem Heim erlebt, in dem mein Vater die letzten drei Jahre verbracht hat. Die Bewohner haben dort teilweise ganze Feiern gesprengt. Als die ganze Verwandtschaft kam und schön auf Weihnachten machen wollte und gute Miene zu furchtbar pikiertem Spiel, da haben sie das aus den Angeln gehoben, dass es nur so krachte. Das fand ich wunderbar.
Wie ging es Ihrem Vater im Heim?
Er wollte dort nicht mehr raus. Die Welt drum herum war ihm zu groß. Er hatte keine Orientierung, er wusste überhaupt nicht, was Wiesbaden heißt oder was Bahnhof heißt. Er wusste, wo sein Zimmer war. Wenn wir im ersten Stock waren, hat er gesagt: „Lass uns hochfahren.“ Sein Zimmer lag im zweiten Stock. Er brauchte diese täglich sich wiederholende Räumlichkeit. Auch die Fragen meiner Mutter, ob er nicht einmal mit nach Hause kommen will, hat er immer verneint.
Es hört sich an, als ob Sie selbst mit dem allen sehr leicht und spielerisch hätten umgehen können.
Ich habe nach vielen Besuchen, wenn ich weggefahren bin, geheult wie ein Schlosshund. Aber ich habe an vielen Stellen auch so gelacht und so einen Spaß gehabt. Ich habe versucht, mitzugehen, zu verstehen, wo so ein Mensch hingeht. Ist das wirklich so schlimm? Die Ruhe, die mein Vater wollte, er wollte keine Filme mehr, auch keine Hörspiele mehr. Er hatte früher so gerne Hörspiele gehört, er wollte das alles nicht mehr, auch keine Fotos. Aber das ist nicht nur leer, es ist eine Welt, die wir nicht verstehen können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das schlimm ist, es ist nur so anders.
Süddeutsche Zeitung | 4.11.2010
Rainer Gansera im Gespräch mit Helena Waldmann
Merkzettel für das Vergessen>
Ein Gespräch mit Helena Waldmann anlässlich der Uraufführung von „revolver besorgen“ bei der Dance 2010 München
Helfer stapeln einen großen Haufen blass gelber Plastiktüten auf der Bühne des Carl-Orff Saals. Helena Waldmann dirigiert die Aktion und probt die Lichtwechsel zu ihrem Stück „revolver besorgen“, das heute 19.30 Uhr im Gasteig uraufgeführt wird. Die Tanzregisseurin, die ihr Handwerk bei Heiner Müller, George Tabori und Gerhard Bohner lernte, packt gern gesellschaftlich virulente Themen an. Um Demenz geht es diesmal und es soll ein Loblied sein auf das Vergessen.
Was will uns dieser Plastiktütenhaufen zum Thema Demenz sagen?
H.W. Diese Plastiktüten sind für uns sehr viel: zuerst einmal einfach Verpackungsmaterial, in dem man sein halbes Leben transportiert haben könnte. Dann: Die Farbe dieser Tüten ähnelt der Farbe des Gehirns. Ich war in Berlin in der Charité am Institut für Neuropathologie – dieser Besuch wird im Stück auch eine Rolle spielen – bei einem Professor namens Frank Heppner. Er hat für uns ein dementes Gehirn lamelliert, und da konnte ich diese eigentümliche Farbigkeit des Gehirns sehen. Irgendwann kommt die Tänzerin Brit Rodemund aus diesem Tütenhaufen heraus und hat eine zerknüllte Tüte in der Hand. Wir nennen diese Szene „Die Hirnforschung“. Diese Tüte wird im Laufe des Stücks eine Rolle spielen: Sie wird zertrampelt, wieder zusammengeknüllt, es wird ein Walzer auf ihr getanzt. Der Tütenhaufen soll sagen: Wir verhandeln hier kein singuläres Problem des „großen Vergessens“.
Ist „großes Vergessen “für Sie ein Synonym für Demenz?
H.W. Der Philosoph Immanuel Kant litt an Demenz, damals aber kannte man diesen Begriff so nicht und sagte: Kant leidet am „großen Vergessen“. Diese Wendung finde ich sehr schön. Es gibt ein Bild von Kant, das heißt „Kant rührt Senf an“, da nimmt er diese typische Haltung ein: geneigter Kopf, Kinn auf der Brust. Bei vielen Menschen mit Demenz kann man das so sehen. Im Stück haben wir das verwendet beim Zitat eines klassischen Balletts. Brit Rodemund ist ja eine klassisch ausgebildete Tänzerin, und die klassischen Rollen, die
hier teilweise zitiert werden, sind in ihren Körper tief eingeschrieben. Aber die se Ballett-Zitate sind alle gebrochen, eine Passage zum Beispiel tanzt sie so mit herunter geneigtem Kopf, wir nennen das immer „Kant-Ballett“. Von Kant gibt es übrigens noch diese wunderbare Anekdote: Er hatte einen Diener namens Lampe, der entlassen wurde, aber Kant konnte sich nicht merken, dass er diesen Diener nicht mehr hatte und schrieb sich einen Merkzettel: „Den Namen Lampe unbedingt vergessen! “ Ein Merkzettel für das Vergessen!
Sie wollen also das „große Vergessen“ rehabilitieren. Aber gibt es nicht viele Situationen, in denen das Erinnern wichtig und heilsam ist, etwa bei der Bewältigung persönlicher oder gesellschaftlicher Traumata?
H.W. Das ist gewiss so. Aber Demenz wird «immer als pures Schreckgespenst beschrieben. Sie ist immer noch ein angstbesetztes Tabu. Natürlich will ich mich jetzt nicht hinstellen und verkünden: Al le Menschen sollen dement werden und sich dem „großen Vergessen“ hingeben. Aber vielleicht ist es so, wie es der Soziologe Gronemeyer im Stück sagt: Viel leicht halten uns die Demenzen einen Spiegel vor, der unsere Lebensumstände befragt. Man kann Demenz medizinisch als Krankheit betrachten wie Heppner aus der Charité oder eben soziologisch, im Sinne dieser Frage: Können uns die Menschen mit Demenz nicht darauf stoßen, dass die Lebenswelt, in der wir uns befinden, diese Welt der totalen Ich-Schreierei, tatsächlich so der richtige Weg ist?
Gibt es biographische Erfahrungen, die Sie zu diesem Thema geführt haben?
H.W. Mein Vater war dement. Ich habe versucht, mit meinem Vater bestimmte Wege zu gehen. Ich habe gelernt: Man muss sich unendlich Zeit nehmen, man muss aufhören, über Worte miteinander kommunizieren zu wollen, man muss anfangen, zum Beispiel über Händedruck mit einander zu kommunizieren. Ich habe ein völlig neues Vokabular des Kommunizierens gelernt. Viele aber schrecken nur schockiert vor der Demenz zurück.
Ist das Theater nicht ein ausdrücklicher Ort des Erinnerns?
H.W. So ist es, und genau deshalb ist es wichtig, sich auf einen Weg des Loslassens zu begeben. So funktioniert eigentlich mein Inszenieren auch. Tabori war ein Lehrer, der mich sehr geprägt hat. Er hat immer damit gearbeitet, den Schauspielern diesen „Theaterkoffer“, diese Dinge, die sie mit sich tragen und auswendig können, radikal wegzunehmen. Zum Beispiel bei der „Warten auf Godot“-Inszenierung: damals mit Peter Lühr und Thomas Holzmann. Die beiden kamen auf die erste Probe und legten die ersten Szenen hin – jeder andere Regisseur hätte das sofort genommen. Tabori aber sagte: „So, Helena, jetzt weißt du, was wir zu tun haben, wir müssen ihnen das ganze Theater wieder wegnehmen.“ Drei Monate hat es gedauert, bis all die aufgesetzten Gesten weg waren. Das ging so ähnlich wie bei den Abbruchkanten einer Demenz. Irgendwann saß Peter Lühr, er spielte den Estragon, dann einfach so da, er war fast ein Kind geworden, und das war großartig.
Sie haben bislang etwa 30 Choreografien geschaffen, gibt es eine thematische Linie, die sich durch diese Arbeiten hindurchzieht – angefangen bei „Due Krankheit Tod“ bis zu „Burka Bondage“?
H.W. Nein, es gibt da schon eine große Vielfalt an Themen, aber ich habe erst in den letzten Wochen verblüfft festgestellt, dass ich zum Thema des Vergessens schon ziemlich viel gemacht habe. Das Stück „Die Krankheit Tod“ beginnt mit dem Satz: „Am besten, Sie kennen mich gar nicht!“ Oder bei „glücksjohnny“ aus der Inszenierungsreihe „Forschung auf dem Feld der Blicke“ lautet Glücksjohnnys erster Satz: „Sie saßen auf Korbstühlen in Havanna und vergaßen die Welt“.
Westdeutsche Zeitung | 21.5.2011
Stefanie Keisers im Gespräch mit Helena Waldmann
Alles vergessen und sich neu erfinden>
Sie ist bekannt für radikale und kontroverse Themen:
Helena Waldmann beschäftigt sich in ihren Tanzprojekten meist mit politischen oder religiösen Zwängen. In ihrem neuen Werk „Revolver besorgen“ zeigt sie, wie die Demenz Menschen einschränkt – aber auch befreien kann.
Frau Waldmann, wie tanzt man das Vergessen?
Helena Waldmann: Indem man los lässt, alles, was man gelernt hat, vergisst. Dafür habe ich eine grandiose Tänzerin engagiert, in deren Körper die Spuren des klassischen Tanzes tief eingeschrieben sind. Sie hat ihre Rollen tausendfach repetiert und verinnerlicht. Damit kann man sehr gut spielen, zeigen, wie dieses Wissen abbricht und dass es gar nicht schlimm sein muss, wenn Dinge verloren gehen. Das Vergessen ist in unserer Gesellschaft sehr negativ behaftet, aber es ist auch eine essenzielle Grundfunktion unseres Gehirns. Wenn man das Fest geschriebene loslässt, kann etwas Neues entstehen. Es hat ein immenses Potenzial.
Gibt es etwas, das Sie selbst gerne vergessen würden?
Waldmann: Teilweise unsere Lebensumstände, unsere festgefahrenen Einbahnstraßen. Es wäre doch schön, könnte man 50 Prozent davon vergessen und dafür mehr Mut haben für neue Situationen. Es wäre befreiend, das Sicherheitsdenken einmal beiseite zu legen, die Sorgen um das eigene Leben und die Zukunft.
Sie haben selbst Erfahrungen mit der Krankheit gemacht.
Waldmann: Ja, mein Vater litt an Demenz. Ich habe ihn acht Jahre lang begleitet und gesehen, was es mit ihm macht. Es gefiel mir nicht, dass unsere Gesellschaft damit überhaupt nicht umzugehen weiß. Die Menschen verschließen sich, weil sie Angst haben. Aber es gab auch positive Momente mit meinem Vater. Ich will die Krankheit nicht schön malen, aber wenn man die Dinge mal von einer anderen Seite betrachtet, merkt man, dass das Leben der Patienten immer noch lohnend ist. Die Worte gehen verloren, dafür tritt eine unglaublich starke Emotionalität hervor, extreme Gefühlsausbrüche wie Schreien oder Lachanfälle.
Spielt der medizinische Aspekt auch eine Rolle im Stück?
Waldmann: Professor Heppner, Chef der Neuropathologie an der Berliner Charité, hat für uns das Gehirn einer Demenzpatientin beschrieben! woran man die Krankheit erkennt. Davon spielen wir während der Aufführung Tonaufnahmen ein. Wir haben auch mit Nina de Vries gesprochen, einer Sexualassistentin, die mit Menschen mit Demenz arbeitet. Im Stück gibt es Aufnahmen aus ihrer Sitzung. Es ist extrem berührend, wie der Patient seine sexuellen Erfahrungen immer neu erlebt, weil er sie ja stets wieder vergisst.
Ähnlich wie im Theater?
Waldmann: Da besteht eine unglaubliche Verbindung zum Theater, wo die Figur immer neu erfunden und erlebt wird. Es ist wie ein Rollenspiel. Und auch beim Theater kann man den Text oder die Schritte vergessen. Das zeigt Brit Rodemund im Stück: Sie tanzt einen Part aus Carmen, aber mit dem Oberkörper verkehrt herum. Ist der Tanz dann falsch, oder nur anders, neu?
Warum haben sie eine klassische Ballerina für dieses experimentelle Stück ausgesucht?
Waldmann: Ich wollte die Fallhöhe so hoch wie möglich ansetzen: Die Zwänge im Ballett sind so gewaltig, alles ist stark codiert und einstudiert. Aus dieser Höhe kann man weit abbrechen, was bei modernem Tanz nicht so anschaulich wäre. Brit Rodemund war dabei ein Glücksfall: Es gibt nicht viele klassische Tänzerinnen in Berlin, die freischaffend arbeiten. Und Sie tanzt ihr 60-minütiges Solo mit einer Dichte und Präsenz, wie man es selten sieht.
„Revolver besorgen“, ist das ein Ausweg aus der Krankheit?
Waldmann: Nehmen Sie Gunter Sachs: Er hat sich den Revolver tatsächlich gekauft und genutzt. Viele Betroffene kommen auf diese Idee, daher auch der Titel des Stücks. Mein Vater sagte mal zu meiner Mutter: „Du musst einen Revolver besorgen.“ Sie fragte: „Wer schießt?“ Er: „Du.“ Meine Mutter: „Und wer erschießt dann mich?“ Er sagte: „Dafür musst du dir dann jemanden besorgen.“ Und beide lachten. Der Dialog war befreiend. Irgendwann muss man sich entscheiden, wie man den Abgang machen will.


tanz jahrbuch 2011
Tom Mustroph im Gespräch mit Brit Rodemund
Tänzerin des Jahres 2011: Brit Rodemund_tanzt die Demenz>
Brit Rodemund tanzt die Demenz. Ein Wagnis, eine Unmöglichkeit, denn die Tanzkunst beruht vor allem auf Weitergabe, Erinnerung, Körpergedächtnis. In Helena Waldmanns Soloprojekt „revolver besorgen“ bricht in die ganze Debatte um das Tanzerbe und die Traditionen jäh das Vergessen ein, ausgerechnet durch eine ehemalige Berliner Staatsopernsolistin, die minutiös den klassischen Bewegungsapparat dem zerfall aussetzt – und dabei unverschämt optimistisch aussieht.
Weit, auch zu weit gehen, ohne sich zu verletzen.
________Brit Rodemund hat ihren grünen Rucksack schon fast wieder in der Hand, als sie sagt: «Vertrauen ist wichtig. Einen guten Choreografen zeichnet aus, ein guter Menschenkenner zu sein. Du musst Vertrauen bekommen, damit Dinge, die man für unmöglich hielt, möglich werden, damit er aus dir Sachen herauszufordern vermag und du diese Forderung zulassen und dann sehr weit gehen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dich benutze jemand.» Mit diesen Worten entschwindet sie durch die Glastür ins Cappuccino-Tischchen-Gewirr des Prenzlauer Bergs. Den Umrissen der zierlichen Frau nachblickend, denkt man irgendwie chemisch: Vertrauen ist die Schlüsselressource, der Treibstoff, der Menschen zusammenbringt und gemeinsam befördert.
Bei «revolver besorgen», dem jüngsten Soloprojekt der Tanzregisseurin Helena Waldmann, hat Brit Rodemund dieses Vertrauen offenbar verspürt. Derart gestützt und umhegt ist sie tänzerisch in Bereiche vorgedrungen, in denen dem menschlichen Intellekt Grenzen gesetzt sind und die Gefühle einer großen Verwirrung unterzogen werden. Brit Rodemund tanzte Demenz. Ein Wagnis, eine Unmöglichkeit eigentlich. «Ich erinnere mich, wie ich irgendwann einfach losgelegt habe und mich nicht mehr dafür interessierte, ob es peinlich wirkte. Ich konnte Widerstände ablegen. Im Vergessensloch, was unsere Probensituation ja auch war, wurde alles möglich: Sabbern, Onanieren, Beschimpfen, Fratzenschneiden und nur eine Sekunde danach Balletttanzen. Irgendwann habe ich aufgehört, an Absicherung zu denken, und bin einfach weiter und tiefer gegangen», so beschreibt sie den Kern der Arbeit mit Helena Waldmann.
Allein um an den Ausgangspunkt der Zusammenarbeit mit Helena Waldmann zu gelangen, musste Brit Rodemund weite Wege zurücklegen. Sie erklomm zunächst Spitzenpositionen im Ballett. Sie war Staatsopernsolistin – mit allem, was es mit sich bringt, in einem Apparat der Perfektion an herausgehobener Stelle tätig zu sein, und mit aller Angst vor jedem noch so kleinen Fehler, der unweigerlich einen ganzen Abend als verloren und zerstört erscheinen lassen konnte. Um neue Freiheiten zu erlangen, künstlerische wie persönliche, ertastete sie später den Interpretationsspielraum der Neoklassik und begegnete schließlich dem zeitgenössischen Tanz. Eine folgenschwere Begegnung. «Ich habe gespürt, es war noch etwa anderes in meinem Körper», sagt sie, um eine Sehnsucht nach unten, nach dem Boden, der Schwerkraft entgegen: «Ich war immer oben, immer auf den Spitzen, immer im Flug», lacht, «und da habe ich gedacht, du musst da unten hin, da gibt es noch etwas anderes, da sitzt eine andere Kraft.»
Sie ging an zu dem von Martin Puttke moderner aufgestellte aalto ballett theater nach Essen und später zu Daniela Kurz in Nürnberg. Seit elf Jahren ist sie nun freie Tänzerin und arbeite unter anderem mit Marco Santi, Nina Kurzeja, Tomi Paasonen, Efrat Stempler und dem niederländischen Choreografenduo Dansity.
Was Brit Rodemund zur Jahrtausendwende bei ihrem Weggang aus dem letzten großen Haus noch nicht genau wusste, aber wohl fürchtete und ahnte, war, dass diese nach oben geöffnete Parabel der produktionsästhetischen Selbstbefreiung mit einer nach unten gekrümmten Parabel im Koordinatenkreuz der sozialen Anerkennung verschränkt sein sollte: Von einer großen, penibel strukturierten Kompanie mit fester Bezahlung und klarem Tagesablauf ging der Weg über lockerer gefasste Zusammenhänge mit weniger Geld und abnehmenden Distinktionsmöglichkeiten in die Welt der freien Tänzer, die heute geheuert und morgen gefeuert werden und sich übermorgen in einem Engagement wiederfinden, das nicht einmal die Kosten für die Miete einbringt, um dabei die Erfahrung machen können, wie paradox und banal zugleich sich das Heute mit dem Morgen und das Übermorgen mit dem Gestern kreuzen.
In «revolver besorgen» nun ist Brit Rodemund ein Bravourstück gelungen, das mehr als zwei Jahrzehnte Tanzerfahrung kondensiert und konzentriert. Die Tänzerin Brit Rodemund und die Tanzregisseurin Helena Waldmann extrahieren Elemente des Balletts. Sie präparieren sie als zarte, zerbrechliche Hüllen und setzen sie dem Bewegungsablauf des Verfalls aus. Giselle, die schwebende Figur des romantischen Balletts, findet sich auf dem Boden sitzend wieder, selbstvergessen mit ihren Schläppchen spielend wie Kinder mit Bauklötzen. Carmen, die Fordernde und Werbende, ist im Oberkörper abgeknickt. Der Blick richtet sich auf die Erde. Die schwungvollen Bewegungen, die Aufmerksamkeit erregen sollen, die Stolz markieren, laufen in etwas Suchendes und schließlich sich selbst Verlierendes aus.
Diese Transformation ist Absicht. Denn «revolver besorgen» zeigt den Verlust auf, den ein Demenzkranker an sich selbst erkennt und erleidet und den – auch und vielleicht vor allem – die anderen an ihm diagnostizieren. «Die Demenz trifft uns im Kern unseres Selbstverständnisses. Deswegen ist sie auch so bedrohlich. Das ist nicht sowas wie Krebs, Tuberkulose oder Syphilis, sondern es ist das, was uns in unserer ureigenen Existent am meisten bedroht», sagt der Soziologe Reimer Gronemeyer in einer Audioeinspielung im Stück. Als «Abbruchkanten» bezeichnet Helena Waldmann dann auch jene Momente, in denen der Kopf nach unten fällt, der Oberkörper zusammensackt, sich die Glieder aber noch immer an jene Bewegungen erinnern, die sie einst ausgeführt haben, die in sie eingeschrieben sind, die sie jetzt reproduzieren und dabei einer Bedeutungsverschiebung unterziehen.
Diese Methode wurde gefeiert. «Ein Höhepunkt der Saison!», jubelte die Tanzkritikerin Melanie Suchy. «Ihre Ballettsequenzen strahlen klassische Schönheit aus, dann bröseln sie, sie erstarrt in Pose oder senkt den Oberkörper, als müsse der Kopf nicht mehr oben sein», schreibt sie. Willibald Spatz lobt bei «nachtkritik» «eine eigenartige Faszination für diesen schwebenden, traumähnlichen Demenzzustand», die durch die Überlagerung von Experteninterviews zum Thema Demenz und Brit Rodemunds Aktionen entstehe.
Auch für die Tänzerin selbst stellte die Produktion einen Meilenstein dar. «Wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte nach einem Bild für das, was ich erreichen möchte, und ich damals ‹revolver besorgen› gesehen hätte, dann hätte ich bestimmt gesagt: ‹Wenn ich da einmal hinkomme, bin ich glücklich.› Denn ‹revolver besorgen› bündelt sehr viel in meinem Leben. Es ist Freiheit darin, Klassik, szenische Momente, Dreck, Reibungen. Es hat alles, was ich mag», sagt sie. «revolver besorgen» ist eine Studie der Erinnerung, ästhetisch wie thematisch. «Ich fand es schön, mich noch einmal ganz groß mit Klassik auseinanderzusetzen. Das war heilsam. Manchmal denkt man ja, man soll dem Gewesenen keine Träne nachweinen. Aber es hat ganz lang zu meinem Leben gehört, und ich mag es auch sehr. Dieses Material zu nehmen und in einen ganz anderen Kontext zu setzen, brachte es mir nicht nur wieder nahe, sondern verlieh ihm gleichzeitig eine neue Dringlichkeit», sagt Brit Rodemund, denn ihr Körper erinnerte sich an alles. Jede Bewegung war eingeschrieben, eingeprägt, zuweilen selbst noch Korrekturen, die vor fast zwanzig Jahren erfolgt sind. «Du machst diese Bewegung, und plötzlich kommt dir diese Korrektur in den Sinn. Das ist schon verrückt», findet sie.
Das Tüfteln am Abbröckeln des Klassischen verlieh diesem körperlichen Erinnerungsprozess eine weitere Dimension – und machte großen Spaß: «Es war unglaublich, damit zu arbeiten, herumzukneten, die Bewegungen auseinanderzuziehen und zu gucken: An welcher Stelle baue ich einen Bruch ein? Wo setze ich das Röcheln im Penché? Was geschieht mit einer Pirouette, die ich mit geneigtem Kopf tanze?» «Es bleibt die ‹Carmen›, das Material der ‹Carmen›, doch es wird spannender, seltsamer», sagt Helena Waldmann und setzte ausgehend von dieser Erfahrung in einem Interview zu einem fundamentalen Diskurs an: «Diese vorgeschriebenen Wege im Ballett sind Quatsch. Warum soll eine klassische Tänzerin ab einem bestimmten Alter nur noch die Mutter tanzen? Das Stück ist ein Plädoyer für einen Ausbruch aus diesen Einbahnstraßen und klar vorgegebenen Richtungen.»
Brit Rodemund ist schon vorher ausgebrochen. Die Tänzerin nahm etwas verärgert zur Kenntnis, dass ihr wegen der neuerlichen Berührung mit Formen des Balletts in «revolver besorgen» nun wieder das Etikett der Ballerina aufgesetzt wurde. «Ich bin das nicht mehr. Seit elf Jahren bin ich freischaffende Tänzerin im zeitgenössischen Tanz», stellt sie klar. Aber sie verhehlt nicht, was die alte Welt ihr gegeben hat: Konzentration, Motorik, eine bestimmte Form der Dynamik, ein geschliffenes Körperinstrument: «Als ich freischaffend wurde, habe ich zunächst gedacht: ‹Das mache ich jetzt nicht mehr, das kann ich wegwerfen.› Doch dann kam mir in den Sinn, dass das alles ja zu mir gehört. Und ich sah, dass viele moderne Tänzer klassisch trainieren, weil dies den Körper anders erzieht.»
Es gibt sogar Dinge, die sie vermisst, die sich bei den gegenwärtigen Produktionsbedingungen des zeitgenössischen Tanzes einfach nicht herstellen lassen: «Ich hätte schon gern eine Garderobe. Dann müsste ich nicht immer diesen grünen Rucksack mit mir rumschleppen», denn freie Tänzer vagabundieren sind von Probenraum zu Probenraum. Zurück in den Ballettbetrieb mit all der Infrastruktur und sogar einem festen Platz an der Stange will Brit Rodemund, selbst wenn sie es könnte, nicht. Lieber unternimmt sie einen weiteren Ausflug in ihr noch wenig vertrautes Terrain. Sie entwickelt ihre eigene Choreografie im Tanz-Akrobatik-Musik-Spektakel «The Time Between», das im August in Tallinn gezeigt wird. Für die Zukunft erhofft sie sich vor allem Vertrauensgaben von Choreografen, um mit ihrem Instrument in neue künstlerische Räume vorzustoßen. Dafür hält sie ihren grünen Rucksack bereit, der all die Dinge enthält, die für einen Tänzerinnenarbeitsplatz wichtig sind. Ein neues, immaterielles Werkzeug darin ist die Radikalität, die sie in der Arbeitsweise bei «revolver besorgen» erfuhr. «Die war ja schon im Thema des Stücks angelegt: Die Freiheit, die im Vergessen liegt, trifft auf Festgeschriebenes, Vertrautes und schon oft Wiederholtes». Es ist ein Paradox, ein Widerspruch, womöglich gar ein dialektischer Zusammenhang, dass eine besondere Qualität des Entdeckens gerade im Vergessen liegen kann. In «revolver besorgen», einem in den Raum geschriebenem Nachdenken über das Vergessen, hat Brit Rodemund ihren Teil zu einen unvergesslichen Abend beigetragen.
Press
english
Dance Europe | 2012, April
by Maggie Foyer
German Dance Platform >
Here Helena Waldmann’s get a revolver scored. It was a sensitive and intelligent exploration of dementia balancing the desperately sad, painful and even funny moments in an outstanding performance by Brit Rodemund. Her expressive face and body covered the spectrum, inhabiting the mind of the old woman while her body recalled the young in a thrilling duality. The ingrained patterns of ballet training, like a poem learnt early and never forgotten, serve as a peg for remembering, while mundane household objects like a plastic bag become a source of great discovery in her unleashed and roaming mind. It was a tour de force for Rodemund, who sustained the character to the climactic and chilling end.
Stuttgarter Nachrichten | 2011, May 9
by Andrea Kachelriess
Even our own body is a wonder >
Helena Waldmann’s work is a godsend for the theatre. The Berlin-based Choreographer is a magician of the stage who knows that a work is only successful when it is able to conjure up illusion. However, her critical intelligence also goes beyond the mechanisms of the theatre to question social and political conventions. In Waldmann’s work, thought and sensuality go hand in hand.
This is beautifully exemplified in her new work “Get a Revolver”, which could be seen at the Stuttgart Theaterhaus on Friday. The solo for Brit Rodemund treats ballet as a symbol of the training that we must all undergo in life on a daily basis. The ballerina enters the stage in goose-step accompanied by a military march. She soon takes up her shoes to goad herself on. But what happens when we suddenly stop functioning, when we forget the steps and the rules of the game and become lost in our own world?
In a formidable performance, Brit Rodemund presents just such a balancing act between a thirst for discovery and the depths of madness. The work’s starting point – as we learn from the recording of a neuropathologist describing a brain dissection – was clinical dementia. However, “Get a Revolver” is also ultimately a reflection on restraints, and the temptation to break away from these.
During the 60-minute performance, Brit Rodemund becomes her own twin: a classical ballerina with dazzling presence, clear lines and wonderful suppleness; then a searcher for whom everything, even her own body or a plastic bag is a source of wonder. Even in difficult moments, she gives her character the dignity a person needs to remain human. Reality, we sense before a shot brings everything to an end, looks different.
Süddeutsche Zeitung | 6.11.2010
by Eva-Elisabeth Fischer
A mountain of nothing >
In a series of ballet variations the ballerina Brit Rodemund nimbly shows how the body’s memory is suddenly interrupted, allowing all movement to die. The recorded voice of a neurologist carrying out a brain autopsy runs through the symptoms of brain shrinkage, ultimately explaining nothing. The ballerina’s hand wanders to her crotch, showing that desire never ends, but that the sense of shame disappears with the understanding. As ever, Waldmann is able to find clever and vivid images for what she wants to describe.
Thüringische Landeszeitung | 23.11.2012
by Sabine Wagner
How someone falls out of the world >
In Helena Waldmann’s “Get a Revolver” the dancer Brit Rodemund gives a face to memory loss. A performance at Jena’s “Theater in Bewegung” festival on Wednesday evening that was as moving as it was harrowing.
According to statistics, in Germany approximately 1.3 million people are currently afflicted by dementia. Each passing year brings more than 200,000 new sufferers. And this figure is set to increase.
But what is concealed behind these sobering facts? What is their meaning for the sufferers themselves, as well as their loved ones? And how does it feel when someone’s relation to reality gradually unravels, when one’s wife, husband and children become strangers, when irrevocable memory loss begins?
These questions are posed by the Berlin-based theatre director Helena Waldmann in her solo project “Get a Revolver”, and in Brit Rodemund she has found a congenial partner. At the festival “Theater in Bewegung” in Jena the former soloist of the Staatsballett Berlin gave a performance that was as moving as it was harrowing.
A bang. The dancer falls like a plank onto the stage. The blare of march music and the rat-a-tat-tat of machine-gun fire. Brit Rodemund shoulders an imaginary weapon, transforming into a proud soldier. Memories of childhood? Perhaps. Memories from the distant past are present; the eyes are still clear. Only when Brit Rodemund removes her shoes, speaks with them, beats her head with them, does the long journey to oblivion properly begin.
To watch how Brit Rodemund falls out of the world, how one moment she is sitting in a café, apparently happy, listening to waltz music, and in another lying on the floor, her hands between her legs, desperately searching for intimate contact with herself, that is both deeply moving and unsettling, and has an intensity that is not easy to bear.
While dancing a scene from “Swan Lake” or “Giselle” and recalling her own experience on the stage, Brit Rodemund, the magnificent classical dancer, is in her element. Suddenly, however, these memories buckle, the swan-arms drop, the chin sinks to the chest, with hanging shoulders the dancer wanders directionless over the stage. From one moment to the next her radiant smile disappears; her eyes become veiled.
Helena Waldmann’s stage is reduced to just a few props: a concave screen that distorts her face; a jumbled heap of orange plastic bags. Brit Rodemund scrunches one up with her hands, listens to it rustle, forms it into a ball, smells it. This is accompanied by a recorded voice reading someone’s living will, a pathologist explaining how to dissect a brain, an elderly lady whispering out her fears: One is simply faced with the facts. But it’s not enough. I fulfilled all my duties, those that were necessary…
That is deeply moving and also unnerving, and makes one infinitely sad and reflective. The performance ends with the heart-warming sound of a baby’s laughter, a sound one wants to hang on to. Then a bang.
Helena Waldmann is a regular at the Jena festival. After such a magnificent performance with the fantastic dancer Brit Rodemund, one can only hope that this will continue. The audience certainly showed its appreciation with enthusiastic applause.
Rheinische Post | 30.5.2011
by Melanie Suchy
Get a revolver >
It starts with a bang. The same at the end. First the sound of war, with an orchestral accompaniment. The dancer falls onto the stage from the side. She marches with an imaginary weapon and snorts. She is a toy soldier, an old children’s game. Right at the end we hear a child laughing, much too long, relentlessly. And the ballerina is swallowed by a mountain of red plastic bags. Shot.
However, the drama here is not death, in whatever form, but the life that comes before. More precisely: memory and forgetting. The title of the new work by the Berlin-based director and choreographer Helena Waldmann is “Get a Revolver” – as one might find on a shopping list.
A highlight of the season! Not only the abrupt changes of light, the crumpled plastic bags, the shoe turned into a hat, and the recordings of scientists and a sex assistant signal dementia and the loss of routine. These are also embodied by the wonderful Brit Rodemund – up to the glazing over of her eyes. Her ballet sequences radiate classical beauty, then crumble. She stiffens into a pose or bows her upper body, as if the head need no longer remain on top.
Dresdner Neueste Nachrichten | 3.5.2011
by Gabriele Gorgas
A lost world >
In her solo work, Helena Waldmann has overridden taboos to confront a human problem with such conviction that it occasionally becomes unbearable. – Since it deals with things that tend to be hidden away, that are hardly compatible with art forms, and even in reality cause such a disturbance that it is difficult to find artistic equivalents. It is a matter of deficits. Those that spread out in a person’s brain, take possession of his or her body, his or her behaviour, let memories be erased, habits forgotten, change lifestyles. This is the difficult task that the director and the dancer Brit Rodemund, a native of Berlin, have set themselves. And during the performance one has the impression that these two independent artists have not made it easy on themselves in their attempt to develop the proper method, and to bring onto the stage, in an authentic way, the inexpressible. But this is what they have unquestionably achieved. With memorable images they have approached a phenomenon that, like some capricious creature, breaths down the necks and sits in the souls of those who no longer fit the normal mould.
tanznetz | 9.11.2010
by Isabel Winklbauer
Those who forget are capable or more >
The ballerina Brit Rodemund perfectly shows the descent from a highly organised structure to a world of improvisation based on individual understanding. At the beginning she marches to a Strauss melody, later switching to ballet steps, then a more expressive form of dance, to end with facial expressions and work on the floor. The “I” becomes increasingly chaotic. However, it is not the dementia sufferer who fails in relation to the conventional; rather, the conventional proves insufficient for the dementia sufferer – this is roughly how Waldmann views the matter. Hence, Rodemund gasps through développés and arabesques, while the improvisations take place in an atmosphere of joy.
Forgetting does not only imply a loss of structure; it can also lead to uninhibited creativity, to no longer being tied to the past. The desire for an eternally youthful spirit is something that Waldmann clearly knows how to evoke. And yet the work as a whole is rather unsettling. With the audio recordings of a brain autopsy or a sex helper at work, the end of romanticism comes quickly. Also the gunshot that marks the beginning and the end of the illness represented in Get a Revolver makes the blood run cold. Dementia is and remains a radical departure from all that is familiar.
Abendzeitung | 6./7.11.2010
by Gabriella Lorenz
What remains in the memory >
The anticipated highlight of the festival DANCE 2010 was the premiere of Helena Waldmann’s Get a Revolver. Dementia has seldom been depicted on the stage with such sobriety and at the same time so movingly. Occasionally with great subtlety, occasionally grotesque and disturbing, the magnificent dancer Brit Rodemund gradually switches from classical dance poses to states of dementia. Audio recordings of specialists as well as sufferers provide us with background knowledge. An extraordinarily strong work.
kulturvollzug.de | 6.11.2010
by Jan Stöpel
Recollections of transience - Memento Dementiae >
Brit Rodemund dances through an ever-diminishing realm of deteriorating consciousness in a way that does not only impress as dance – performed with a great tension and precision – but also as theatre. Her concentrated performance turns the evening into a grim memento dementiae. Dance is employed persuasively: partly for the sake of narrative and partly as a contrast agent. The way Brit Rodemund dances the most challenging figures while simultaneously struggling for breath, gasping even, like someone critically ill – this contradiction clearly describes the demands of physical deterioration. At the end of the performance, the laughter of children can be heard in an endless loop – for as long as it takes for the laughter to lose any sense of joy. This is what happens when people become odd – or, in another interpretation, childish. Or is it true that, in their recollections, the elderly sometimes return to their early childhood? Brit Rodemund disappears beneath this dreadful laughter into a heap of plastic bags that resembles a brain, but which might also suggest the dregs of memory. Finally a shot rings out. The evening is a provocation. But one that is nowhere near as great as the possibility of being abandoned in this way by body and mind.

german
Neue Westfälische Zeitung | 2.8.2013
von Heike Krüger
Brit Rodemund tanzt großartiges Solo >
Bielefeld. Demenz tanzen – wie soll das gehen? Das werden sich nicht wenige Zuschauer gefragt haben, die mit Spannung den Tanzabend „Revolver besorgen“ von Helena Waldmann erwartet haben. Was Solistin Brit Rodemund dann auf die Bühne im Theaterlabor zaubert, ist ohne Übertreibung mit dem Superlativ „großartig“ zu belegen.
Doch neben der außergewöhnlichen, physisch fordernden und mit tiefer Emphase getanzten Leistung der Solistin steht das Konzept der Choreografin. Helena Waldmann bedient sich bei der Bearbeitung des schweren Themas eines durchgängigen Musters: Sie konterkariert Stimmungen, geschaffen durch Musik, Bewegungen oder Laute der Tänzerin mittels abrupter Kontraste, kleiner Störfeuer.
So unterbricht sie Walzerseligkeit durch Gewehrsalven, schürt Erinnerungen an die Erinnerungen der Weltkriegsgeneration. Der Tanz mit den Schuhen endet in einem Scharmützel mit selbigen, die sich wie von Geisterhand geführt gegen die Trägerin wenden. Das Wiegen zum romantischen Song „Unforgettable“ geht einher mit einem endlos scheinenden Speichelfluss, der der Solistin aus dem Mundwinkel rinnt. Ein starkes Bild.
Waldmann gießt die Bedrohung durch die fremde Macht Demenz, die allmählich Besitz von den Betroffenen ergreift, während die das anfangs noch schmerzlich mitbekommen, in deutliche Bilder. Brit Rodemunds schauspielerische Begabung ist ebenso gefordert wie ihr tänzerisches Können, wenn sie ganz ohne Tabus zeigt, wie es um die sexuellen Bedürfnisse eines Demenzkranken bestellt ist.
Und was es bedeutet, in einer Endlosschleife aus Wiederholen und Vergessen gefangen zu sein. Es ist ihr Verdienst, dass sie das für ihr Publikum nahezu erlebbar macht.
Die Bühnenausstattung ist auch deshalb so gelungen, weil sie so schlicht gehalten ist. Nur ein Haufen oranger Einkaufstüten in einer Ecke scheint die verschiedenen Erinnerungsfetzen oder das Gehirn an sich zu repräsentieren, auf die die Tänzerin ab und zu noch zugreifen kann. Sie tanzt mit den Tüten, spielerisch zunächst, plötzlich hält sie einen aus einer Tüte geformten Revolver an ihre Schläfe.
Alt, vergesslich, inkontinent – ist die ultimative eine Lösung des Problems? Waldmann spart Drastik nicht aus. Auch wenn ein Pathologe aus dem Off betont sachlich anhand eines dementen Gehirns erklärt, wie sich die Krankheit medizinisch darstellt. Anrührend kontrastieren damit die Kommentare Betroffener: „Ich werde einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und soll damit zufrieden sein“, sagt eine alte Dame resigniert.
Nach und nach ist die Tänzerin, deren Bewegungen immer eckiger, die Mimik hinter einem riesigen Vergrößerungsglas immer entrückter wird, der Welt vollends abhanden gekommen. „Ich leb allein in meinem Himmel, in meinem Leben, in meinem Lied“, klingt es aus dem Lautsprecher, während sie schluchzend und stöhnend weiter tanzt. Dann versinkt sie im Tütenhaufen, während ein lachendes Kind zu hören ist – und dann doch noch der (erlösende?) Schuss fällt.
Tosender Applaus und Jubel für eine reife Leistung.
Augsburger Allgemeine Zeitung | 6.7.2013
von Dagmar Hub
Geistesblitze aus dem Land des Vergessens >
Tanz die Demenz. Das klingt so, als dürfe man es nicht. Die Leichtigkeit des Tanzes und die zerstörerische, bedrohliche Krankheit, das scheint sich zu widersprechen. Was aber die ehemalige Solotänzerin des Berliner Staatsballetts, Brit Rodemund mit „revolver besorgen“ zeigte, das geht derart unter die Haut, dass man ergriffen aufatmet, als der Bann nach 60 Minuten vorbei ist. Und doch möchte man noch einmal sehen, wie die „Tänzerin des Jahres“ 2011 Rodemund das absolute Wagnis umsetzt, eine Frau zu tanzen, die sich selbst und alle gesellschaftlichen Regeln vergisst.
Es ist ein Bravourstück, das der großartigen Rodemund unter der Regie von Helena Waldmann gelingt: Der Körper verliert die ein Leben lang eingeübten Bewegungen nicht, aber er weiß nicht mehr, wozu er sie früher gebraucht hat. Das Suchen nach den Zusammenhängen, das Verlieren, die Freude über eine spielerische Entdeckung, die wieder kindliche Neugier, auszuprobieren, was man mit einem Pantoffel oder einer Plastiktüte machen kann – und der Zorn darüber, dass sich die Zusammenhänge nicht mehr erschließen, die doch einmal so logisch waren, das bringt Rodemund mit eindrucksvoller Mimik, nüchtern und zugleich zutiefst ergreifend auf den Punkt.
Die raschen, von außen so befremdlich unmittelbar wirkenden Stimmungsschwankungen der Demenz erschließen sich im Tanz, wenn Bruchstücke des früher Erlebten – der Erste Weltkriegs, der Swing, die Zeit der Kindererziehung – auftauchen. Das Selbstvergessen ist der Sturz aus allen Zusammenhängen, es ist aber auch die Befreiung aus jedem gesellschaftlichen Funktionierenmüssen: Rodemund tanzt die angstvolle Erkenntnis des Vergessens derart ausdrucksstark, dass es dem Publikum den Atem raubt. Und sie geht wie in einem Zerrspiegel tief in das Wagnis hinein, Demenz zu tanzen: Sabbern, onanieren, Fratzen schneiden, glückliches Experimentieren mit den Dingen des Alltags, die ihre Bedeutung verloren haben, und die Aggression über die Ahnung, dass es diese Bedeutungen doch einmal gab.
Die Stimmen aus dem Off sind fast ein Hörspiel in sich: der Professor, der ein erkranktes Gehirn vor seinen Studenten seziert und erklärt, die Sexualtherapeutin im Gespräch mit einem dementen Mann, und immer wieder das Lachen eines Kindes, ein Lachen, das sich im Tod der dementen Protagonistin in einer Endlosspirale wiederholt. Ein radikales Wagnis, ein mutiger – und dabei unglaublich ästhetischer – Beitrag zur gesellschaftlichen Demenzdiskussion: Im Vergessen liegt nicht nur Verlust, sondern ebenso Freiheit vom Festgeschriebenen.
Schaffhauser Nachrichten | 28.6.2012
von Claudia Härdi
Schön grotesk, fragil und brutal zugleich >
Die Tänzerin Brit Rodemund fällt mit einem lauten Knall auf die Bühne. Mit einem Schlag setzt die Musik ein, die Tänzerin springt auf und marschiert in grotesken Exerzierschritten auf und ab. Ihre Sandalen klatschen rhythmisch auf den Bühnenboden. Mit diesem Auftakt war es von der ersten Minute an klar, dass das Publikum nicht mit einer gewöhnlichen Tanzperformance, sondern mit einer gänzlich unbekannten konfrontiert werden würde. Die Tanzperformance «revolver besorgen», die am Eröffnungsabend des Rheinfallfestivals gezeigt wurde, stellt die Demenz, das Vergessen, das flüchtige Erinnern, den Verlust und den Schmerz, aber auch das Glück schonungslos in bewegenden Bildern und Tönen dar. In diesem einstündigen Soloprojekt, das der Fantasie der Tanzregisseurin Helena Waldmann entsprungen ist, sind die grazilen, minuziösen Bewegungen des klassischen Balletts dem Zerfall ausgesetzt. Die Figur verbröselt. Dann und wann aber fängt sie sich wieder auf. Krümmt sich. Bäumt sich auf gegen das Vergessen. Die Hemmungen fallen, und das Trieb- hafte des Menschen greift durch, um dann abrupt wieder in das Schöne, das leichtfüssige, disziplinierte Schweben einer Ballerina überzugehen. Stolz und aufrecht. Gekrümmt und verloren. Suchend tastet die Tänzerin mit den Händen den Boden ab. Schön, grotesk, brutal und verwundert zugleich zeigt sie die zarten zerbrechlichen Hüllen des menschlichen Körpers, einer Person, der ihre vertraute Welt abhanden gekommen ist. Überlagert wird die Tanzperformance mit Gesprächen aus dem Off. So ist zum Beispiel in einer Szene ein Pathologe zu hören, der, während er ein Gehirn seziert und in Scheiben schneidet, jeden seiner Schritte detailliert erläutert. «revolver besorgen» ist ein eindrückliches, unvergessliches Stück, das aber auch sehr viel vom Publikum abverlangt. Es verstört. Konfrontiert. Das Publikum bleibt von der Innenweltsicht der Tänzerin ausgeschlossen und hat beklemmende Szenen auszuhalten. Gleichsam wird dadurch auch die Stille, in der die Tänzerin erstarrt und in ihrem Spiel innehält, beinahe unerträglich. Das Stück berührt und bewegt. Die Tänzerin, die mit ihren Gesten und Bewegungen das Vergessen in den Raum einschreibt, taucht immer tiefer in ihr eigenes Lied ein. Entfernt sich und lässt den Zuschauer in seiner Aussenwelt immer weiter zurück. Das Publikum jedenfalls hat das Stück ausgehalten. Was bewundernswert ist. Für die aussergewöhnliche und brutal-brillante Performance gab es denn auch einen grossen Applaus.
Badische Zeitung | 31.3.2012
von Annette Mahro
Neben den Abgründen >
Wie ein Brett fällt die Tänzerin aus den Kulissen und robbt auf das Schlachtfeld Bühne. Mit einem Schlag setzt Musik ein, die die aufgesprungene Brit Rodemund mit Exerzierschritten und immer neuem imaginären Gewehrpräsentieren beantwortet. Ton und Bewegung sind da miteinander in eine Endlosschleife geraten, aus denen sie erst diese Sequenz aus Gustav Mahlers Kindertotenliedern erlösen wird. „Revolver besorgen“ hat Helena Waldmann ihre Solochoreographie zum Thema Demenz genannt. Ein begeisternder Abend zwischen klassischem Ballett und Themenperformance, der jetzt im Lörracher Burghof zu Gast war.
Die Tanzregisseurin, die schon früh mit Größen wie Heiner Müller und George Tabori gearbeitet hat, nutzt für ihre bühnenseitige Weltsicht ungewöhnliche, gerne gebrochen verstörende Blickwinkel. Eine Innensicht der uns alle bedrohenden Welt des Wissens- und Erinnerungsverlustes kann nicht gegeben werden. Was die selbst knapp 40-jährige frühere Primaballerina Brit Rodemund auf der Bühne dagegen Schritt für Schritt, auch stolpernd und sich regelrecht in eigenen Bruchstückerinnerungen verfangend entwickelt, ist eine Außensicht – so könnte es sein – die bewusst auch Befreiendes und außergewöhnlich schöne Bilder hat. Sie stehen neben Abgründen. Das Stück will und kann nicht stellvertretend für jede Form der Demenz stehen. Beispielhaft nimmt es dagegen die Figur der Tänzerin, die sich an Tanzfiguren, etwa an Giselle oder den schwarzen Schwan erinnert.
Mit mächtig gebreiteten Schwingen und in nahezu abhebend fließenden Armbewegungen schwebt da eine Meisterin ihres Fachs, die ohne jedes Schwanenkostüm, ohne Röckchen und Dekor ihre Figuren lebendig werden lassen kann. Noch bevor sich das Publikum aber in soviel bewegte Schönheit wirklich hat einsehen können, folgt wieder ein Bruch, das nächste Abbröckeln schließt sich an die Eingangsszene an. Dann gibt es Phantasieeinlagen, Großartiges, wie die mit abgeknicktem Oberkörper quasi auf dem Kopf getanzte Carmen. Als Hauptrequisiten nutzt Brit Rodemund auch hier ihre anfangs zum Stechschritt noch klappernd getragenen Absatzsandalen. Der Carmen werden sie zum Fächer, der Tanzelevin zum die Glieder einzeln züchtigenden und den Körper auf Perfektion trimmenden Schlaginstrument und der nach der Erinnerung Suchenden schließlich zum Handspiegel und Streitpartner.
Ein Berg in einer Ecke halb geknüllt, halb geplustert liegender blassroter Plastiktüten wird daneben zum bald magisch leuchtenden Bühnenbild. In einer Szene verliert sich die Tänzerin in diesen Tüten regelrecht, die verkörperte Krankheit lässt sie im Erinnerungsmüll graben, aber auch tief in das form- und zeitlose Material eintauchen und damit eine Art Meeresrauschen erzeugen. Vertont wird der Abend mit einem seinerseits in Bruchstücke zerfallenden Radiofeature, für das neben Helena Waldmann die radioerfahrene Dramaturgin Dunja Funke verantwortlich zeichnet. Aus collagierten Originaltönen lassen sich Teile der fürs Stück recherchierenden Vorarbeit nachvollziehen. Der Soziologe Reimer Gronemeyer beschreitet da etwa mit seiner Ursachenforschung neue Wege, während der Neuropathologe Frank Heppner mit klirrendem Besteck und jeden Schritt kommentierend ein vom Zerfall betroffenes Hirn seziert.
Immer wieder durchbrochen wird alles von meist leicht zuzuordnenden Klängen. Tief in die musikalische Erinnerung, die der Abend hinterlässt, gräbt sich titelgerecht Nat King Coles „Unforgettable“. Hier mag es sowohl die übrig geblieben Bruckstücke meinen als auch die vordem Gekannten. Helena Waldmanns „Revolver besorgen“ ist ihrem vor zwei Jahren gestorbenen, seinerseits dementen Vater gewidmet. Das Denkmal, das sie darin aufrichtet, will ausdrücklich einen Teil des mit der neuen Volkskrankheit verbundenen Entsetzens relativieren. Brit Rodemund hat in Tanzperfektion glaubhaft und ohne den geringsten Verschleierungsversuch etwas Großes geschafft.
Münstersche Zeitung | 26.3.2012
von Helmut Jasny
Kapriolen des Geistes >
„Ich bin der Welt abhanden gekommen“, heißt es in einem Rückert-Lied von Gustav Mahler, das sich wie ein Leitmotiv durch das aktuelle Tanzstück von Helena Waldmann zieht. In „Revolver besorgen“ setzt sich die Berliner Choreografin mit dem Thema Demenz auseinander. Sie schöpft dabei aus eigener Erfahrung mit ihrem Vater. Inspiriert wurde der Titel von einem Dialog zwischen ihm und seiner Frau, der mit dem Worten „Du musst einen Revolver besorgen“ begann. (…) Es sind Zustände tiefster geistiger und seelischer Verwirrung, denen Brit Rodemund hier Ausdruck verleiht. Der Verstand spielt Kapriolen und das Gedächtnis verselbstständigt sich, wenn die ehemalige Staatsopern-Ballerina mit grotesk überzeichneten Bewegungen über die Bühne marschiert und ein imaginäres Gewehr präsentiert. Bei einem Trinkgelage mutiert sie zu einer mechanischen Puppe, die außer Rand und Band gerät, um dann zu einem grässlich verzerrten Jodler die Hosen runterzulassen oder hingebungsvoll sabbernd einer amerikanischen Liebesschnulze zu lauschen.Rodemund gelingt bei ihrer Darbietung ein erstaunlicher Balanceakt. Einerseits zeichnet sie die innere Not und Verlorenheit eines Demenzkranken nach, andererseits entwickelt ihr Tanz eine außerordentliche, geradezu klassische Ästhetik, die immer wieder durch komische Einlage gebrochen wird – etwa wenn sie sich ein Glasprisma, das wie ein Vergrößerungsglas wirkt, vor das Gesicht hält und damit grimassierend vor dem Publikum auf und ab läuft, während aus dem Off ein Arzt die verschiedenen Symptome der Demenz erklärt oder ein Pathologe mit wissenschaftlicher Akribie über die Vorgänge beim Sezieren eines Gehirns spricht.
Eine beeindruckende Inszenierung, die trotz des düsteren Themas vor Schönheit strahlt.
Neues Volksblatt | 15.3.2012
von Birgit Thek
Angstthema "Der Welt abhanden kommen" >
„Revolver besorgen“ nennt sich die Arbeit der Berliner Choreographin Helena Waldmann, die am Dienstag den ersten Höhepunkt der TanzTage im Linzer Posthof bildete. Sie spielt damit auf einen Wunsch ihres demenzkranken Vaters an und setzt sich mit dem
Angst besetzten Thema des Ich-Verlusts auseinander.
Mit einem Knall beginnt und endet das Stück, in dem die Tänzerin Brit Rodemund den Kern unseres menschlichen Selbstverständnisses umkreist. Im Stechschritt kommt sie auf die Bühne, bevor sie einen Schuh auszieht und sich diesen auf den Kopf setzt. Was ist ein Schuh? Was ist meine Haut? Nichts ist mehr selbstverständlich für einen Menschen, der sein Gedächtnis verliert – er ist der Welt abhanden gekommen und lebt jetzt in seinem eigenen Himmel, wie das eingespielte Mahler-Lied nach einem Text Friedrich Rückerts stimmig verdeutlicht. Ebenso eindrücklich Brit Rodemunds Leistung: Sie bringt ihr Repertoire der ursprünglich klassischen Ballettsolistin ein, wenn sie sich ganz auf sich selbst bezogen dreht und vor Freude springt. Die Erinnerungen an früher knicken jedoch plötzlich ein, der Blick wird fragend, die Bewegung stoppt – Orientierungslosigkeit wechselt mit freier Improvisation, denn im Vergessen kann auch ein Ausbruch aus den Alltagscodes und -zwängen liegen.
Trotzdem hatte man als Zuschauerin bei aller Begeisterung für diesen intelligenten und einfühlsamen Abend einen Kloß im Hals, so nahe rückte einem das Thema.
Trierischer Volksfreund | 7.2.2012
von Dieter Lintz
Der Welt abhanden gekommen: "Revolver besorgen" in Luxemburg >
Eine weiße, quadratische Bühnenfläche. In der Ecke ein aufgetürmter Haufen durchsichtiger, organischer Plasiktüten. Ein überdimensionales Vergrößerungsglas als einziges Requisit. Eine sparsame Ausstattung.
Aber es braucht nicht mehr, wenn man eine klassische Tänzerin mit der Ausdruckskraft von Brit Rodemund hat. Selten erlebt man Tanz so nahe, so unmittelbar, kann die Arbeit und die Anstrengung nachvollziehen, hört das Atmen, sieht, wie sich das Gesicht rötet. Sie lässt Nähe zu – und holt den Zuschauer damit unmittelbar in das Stück hinein.
Demenz als Thema einer Choreographie: Das sorgt für Unbehaglichkeit.
Dabei hinterlässt der Abend alles andere als deprimierende Gefühle. Waldmann badet nicht in Verzweiflung, sie setzt filigran, persönliche Beobachtung in Bewegung um.
Wie selbstverständlich Dinge plötzlich fremd werden. Wie sich Vorgänge immer neu wiederholen. Wie die Tänzerin eine orangefarbene Tüte mit Erinnerungen öffnet, sie freilässt, mit ihnen spielt, sie wieder vergisst. Wie sich Gedächtnis und Körper deformieren, wie Zweifel und Verwunderung Einzug halten. Wie der Zerrspiegel einen Menschen verfremdet, sein Gesicht ins Lustige oder Tragische verändert -, und trotzdem bleibt es derselbe Mensch.
Das sind verblüffende Bilder, weil sie radikal die Sicht des Betroffenen einnehmen. Natürlich weiß niemand, was im Kopf eines Demenzkranken vorgeht, aber Waldmann kommt der Sache womöglich näher als jede medizinische oder wissenschaftliche Analyse.
Da ist kein Platz für Resignation. Wenn im Hintergrund Mahlers „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ erklingt oder Frank Sinatras „Unforgettable“, dann wirkt das kein bisschen zynisch oder distanziert, so wenig wie die Einblendung von Orginaltönen eines Radiofeatures oder der Mitschnitt einer Gehirnsektion in der Berliner Charité.
Am Stärksten in der Schluss: Die Hauptfigur verschwindet im orangenfarbenen Berg der Erinnerungen, begleitet von einem ungeheuer ansteckenden Kinderlachen. Demenz als Rückkehr in den Schoß der Kindheit und des Lebensbeginns: Dass es in der Empfindung der Kranken so sein könnte, ist ein tröstlicher Gedanke. Langer, respektvoller, von Sympathie getragener Beifall.
Stuttgarter Nachrichten | 8.11.2010
von Isabel Winklbauer
Positive Aspekte des Vergessens >
Ein Stück über Demenz beim Münchner Dance-Festival
Demenz als Chance zu betrachten, das scheint verwegen. Zu groß ist die Angst des Menschen, am Ende des Lebens sich selbst zu verlieren. Die Berliner Choreo-grafin Helena Waldmann indes dringt in ihrem Stück „revolver besorgen“, beim Münchner Dance-Festival uraufgeführt, in die Erlebniswelt einer Vergessenden ein und findet dort viel Positives.
Ballerina Brit Rodemund zeigt perfekt den Abstieg von der hochstrukturierten Geisteswelt zum improvisierten Individualverstand: Anfangs marschiert sie zu einer Strauß-Melodie, wechselt dann zu Ballettschritten, gelangt zum Ausdruckstanz und endet bei Gesichts- und Bodenarbeit. Das Ich wird chaotischer – doch nicht der Demente scheitert am Konventionellen, sondern das Konventionelle ist unpassend für den Dementen, so sieht es Waldmann. Daher röchelt Rodemund zu Developés und Arabesken ziemlich ungut, bei Impro- visationen hingegen strahlt sie.
Wer vergisst, kann mehr – Demente er- forschen nicht nur ungeniert ihren Kör- per, sie können auch tiefer in Gedanken wühlen. So entstehen neue Ideen, etwa die eines Revolvers, mit dem sich der feindlichen Welt der Konventionen ent- fliehen ließe. Rodemund formt eine ihrer leeren Plastiktüten – sie stellen Erinnerungen dar – zur Waffe; doch letztlich zerknüllt sie sie. Vergessen, das heißt nicht nur Struktur verlieren, das heißt auch
ungebremst kreativ sein, nicht an Altem kleben. Diese Hoffnung auf eine ewig junge Geisteswelt weckt Waldmann durchaus.
Und doch ist das Ganze unheimlich. Bei Audioeinspielungen einer Gehirnautopsie oder einer Sexualhelferin bei der Arbeit ist das Ende der Romantik schnell erreicht. Auch der Schuss, hier Anfang und Ende der Krankheit, lässt das Blut in den Adern gefrieren. Das große Vergessen ist und bleibt ein radikaler Abschied von allem.
nachtkritik.de | 5.11.2010
von Willibald Spatz
Die Abschaffung der Welt >
München, 4. November 2010. Deutschland wird immer älter. Im Moment leben 1,2 Millionen Betroffene innerhalb dieser Grenzen, jährlich werden es angeblich 250.000 mehr.
So steht es im Programmheft von Helena Waldmanns „revolver besorgen“. Das Theater ist ein denkbar geeigneter Ort einer solchen Auseinandersetzung, denn die Bühne ist ein Ort des Erinnerns – vergisst ein Schauspieler seinen Text, fällt er aus seiner Rolle. Das kann lächerlich werden und peinlich und damit wird er einem Dementen ähnlich. Der hat auch keinen passenden Text mehr zur Situation, er weiß nicht mehr, was der Augenblick erfordert, im frühen Stadium leidet er darunter, weil ihm das noch bewusst wird. Später scheint er den Frieden mit sich gefunden zu haben.
Der Zugriff auf die Welt: verloren
„revolver besorgen“ zeichnet diesen Weg nach: Die Tänzerin Brit Rodemund marschiert zu zackiger Musik auf einer bis auf einen orangefarbenen Tütenhaufen leeren Bühne auf und ab, hin und wieder rattert der Ton von Maschinengewehrfeuer durch die Musik. Rodemund ahmt ihn nach, leicht verzögert, es geht ihr was verloren: die Erinnerung, der Zugriff auf die Welt von früher, ein Stück Persönlichkeit. Sie zieht sich ihre Schuhe aus, die sie eben zum Stampfen auf den Boden noch benötigt hat und moderiert stumm einen Streit zwischen den beiden, die nun keine Schuhe mehr sind, sondern Gesichter. – Die Wirklichkeit verändert sich, sie behält für den, der sich in ihr bewegen muss, aber ihre Logik.
Auf Worte verzichtet die Aufführung nicht ganz. Sie kommen aus dem Off und stammen großteils aus Interviews und O-Tönen von Patientenbegegnungen für ein Radiofeature, das Helena Waldmann zusammen mit Dramaturgin Dunja Funke produziert hat. Diese Feature-Fetzen amüsieren und irritieren allein schon beim Hören; die darübergelegten Aktionen Rodemunds lassen eine eigenartige Faszination für diesen schwebenden, traumähnlichen Demenzzustand entstehen. Wir hören die Sexualassistentin Nina de Fries einen Mann anleiten, ihre Vagina zu erkunden und sehen dazu Rodemund am Boden mit dem Rücken zum Publikum. Zwischen ihren Beinen streckt sie ihre Hand aus und vollzieht grapschende Bewegungen.
Der Pathologe Frank Heppner ist zu hören, wie er ein Gehirn seziert, in Scheiben schneidet und jeden Schritt detailliert erläutert. Als er beim Großhirn angekommen ist, packt Rodemund ihre Schuhe stellvertretend für die beiden Hirnhälften in Plastiktüten. Dieses Hirn wiege nur 1088 Gramm, ein eindeutiges Zeichen für Hirnschwund.
Der Ego-Zentriertheit entkommen
Das Finale ist hirntechnisch gesehen identisch mit dem Anfang: Man wird wieder zum Kind. Für das Kind ist alles neu auf der Welt, man darf alles zum ersten Mal erfahren, sich daran freuen und darüber lachen. Das Kind kennt keine Sorgen und keine Tragik, es lebt jeden Tag wie den ersten und zugleich den letzten. Jede Beschäftigung mit einer Sache ist absolut, es gibt keinen Zweck mehr, alles geschieht nur für sich selbst – die perfekte Kunst. Nur das Kind und der hochgradig Demente können dorthin gelangen. Zu Kinderlachen vom Band kriecht Rodemund in den Tütenhaufen, der die ganze Zeit auf sie gewartet hat – ihr Hirn, mit dem sie nun ganz eins ist. Die Welt ist ausgeschlossen.
Helena Waldmann hat sich bei den Recherchen für dieses Projekt tief hineinziehen lassen. Und dem Gedanken ans (eigene) Ende die Chance abgerungen, mit dem Verlust der Persönlichkeit der Ego-Zentriertheit unserer Gesellschaft zu entkommen.
Deswegen ist „revolver besorgen“ keine Sekunde kitschig oder bitter oder zynisch – in diese Richtung gleiten andere Alzheimer-Geschichten auf der Bühne gern ab. Hier sorgen kraftvolle Bilder und berührendes Wortmaterial für eine schöne Erkenntnis. Schade nur, dass die Uraufführung im Rahmen des alle zwei Jahre abgehaltenen Dance-Festivals stattgefunden hat. Aus Angst, nur ein Spartenprogramm serviert zu bekommen, meiden zu viele die Veranstaltungen des Festivals. Um „revolver besorgen“ gut zu finden, muss man allerdings kein Anhänger von Tanztheater sein.

Conversations
dement-sprechend im Feature
german
Gespräch mit Professor Dr. Frank Heppner, Leiter des Instituts für Neuropathologie, Charité Berlin
moderiert von Helena Waldmann und Dunja Funke | 2010
Wie kann ich mir Ihre Arbeit als Neuropathologie in Zusammenhang mit Demenz vorstellen?>
Hier ist das Interview mit Fotos im Sektionsaal
Herr Professor Heppner, Sie sind Neuropathologie. Wie kann ich mir Ihre Arbeit als Neuropathologe in Zusammenhang mit Demenz vorstellen?
Wir sind als Neuropathologen erstmal diejenigen, die ein Gehirn untersuchen und die Demenz an einem Gehirn feststellen. Das ist typischer Weise eine Untersuchung, die nach dem Tode, also im Rahmen einer Obduktion, stattfindet. Und hier sind wir diejenigen, die die Gewebeveränderungen wirklich festmachen können. Gewebeveränderungen sind ja letztlich die Ursache dafür, was der Patient zeitlebens erlebt hat.
Sind Ihnen die Patienten zu Lebzeiten schon bekannt?
Wir sind als Neuropathologen nicht mit dem Patienten direkt befasst. Wir kennen ihn indirekt über die klinische Akte, die uns mit dem Patienten mitgereicht wird. Mit der Übersendung der Leiche und mit der Bitte, um die Untersuchung des Gehirns. Auf Grund der Krankenakte ist ein Patient sehr gut archiviert und dokumentiert und wir als Pathologen sind gut informiert, was mit dem Patienten klinischerseits los war.
Wird dann nach der Obduktion die Art der Demenz festgestellt?
Ja, das ist eine wichtige Funktion der Neuropathologen, die auch so vielen nicht bekannt ist: eine Demenz ist eben nur ein klinisches Syndrom. Das ist ein Potpourri von vielen möglichen Ursachen. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von Demenz und ganz viele verschiedene Ursachen. Es gibt nicht nur die Wichtigste, die wir alle kennen, den Morbus Alzheimer, sondern noch viele andere Formen. Und da diese eben eine gewisse Konsequenz haben – einige von den Alzheimer Fällen und einige von den Nicht-Alzheimer Fällen haben genetische Ursachen. Es ist wichtig, dass die Angehörigen davon erfahren, weil es möglicherweise familiäre Konsequenzen haben könnte und sich ein Angehöriger fragt, ob er auch betroffen sein könnte. Von daher sind diese Diagnostik und die Aufarbeitung nach dem Tode sehr wichtig.
Was ist der Unterschied zwischen Alzheimer und vaskulärer Demenz?
Der Morbus Alzheimer hat eine ganz typische Form der Darstellung am Gewebe. Wenn wir ihn untersuchen, zeigt er ganz typische Veränderungen. Die vaskuläre Demenz ist streng genommen eine, die auf der Basis von Gefäßverengung, also Gefäßverkalkung, Arteriosklerose beruht.
Das perfide ist aber, dass es sehr viele Mischformen gibt. Es gibt die sogenannte Misch-Demenz, wo typische Alzheimer Veränderungen und typische vaskuläre Gefäßveränderungen stattfinden und man dann eben von einer Misch-Demenz spricht. Das heißt, es gibt in diesem Spektrum einmal den Alzheimer und am anderen Ende des Spektrums die vaskuläre Demenz und dann gibt es in der Mitte die Mischformen. Es ist sicher ein Formenkomplex, der zusammengehört. Daneben gibt es ganz viele andere Formen der Demenz.
Können Sie eine Zahl nennen, wie viele verschiedene Formen der Demenz man mittlerweile voneinander unterscheiden kann?
Eine Zahl ist schwer zu formulieren. Erstmal muss man sagen 90% – 95 % sind Morbus Alzheimer/vaskuläre-/Misch-Demenzen. Das ist mal das größte Spektrum. Bei den restlichen 10%, um hier mal eine Zahl zu nennen, kennen wir sicherlich 50-80 verschiedene Demenzformen.
Wie unterscheidet sich optisch ein gesundes von einem dementen Gehirn?
Wir unterscheiden zunächst die makroskopischen Unterschiede. Die Untersuchung des gesamten Gehirns, also alles, was man mit dem bloßen Auge sehen kann. Bei einem dementen Gehirn finden wir dort typischerweise Hirnschwund. Atrophie nennen wir das. Die ist auch als global zu bezeichnen. Das heißt, dass gesamte Gehirn ist eigentlich relativ gleichförmig geschrumpft. Es gibt keine päeferenziellen Regionen am Gehirn, die Gehirnschwund aufweisen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es andere Formen, jenseits des Morbus Alzheimer gibt, die z. B. nur frontal atrophisch verändert sind.
Wenn wir das Hirn aufschneiden, dann sehen wir die Ventrikelräume, das ist der Raum, wo das Hirnkammerwasser fließt, und wir sehen, dass diese Kammern geweitet sind. Das hat seine Ursache darin, dass das Hirngewebe atrophisch geworden ist. Dadurch werden die Hohlräume größer. Das nennt man dann Hydro C Verlust I vakuuo. Das ist auch etwas, was sehr offensichtlich ist, weil eben diese Kammerwasserräume dann extrem vergrößert ausschauen.
Was wichtig ist für ein Hirnschwund, ist das Gewicht. Wir wiegen ein Gehirn.
Ein Gehirn hat typischer Weise 1200g -1300g und ein atrophisches Gehirn hat meistens deutlich unter einem Kilogramm. Das sind doch wirklich große Unterschiede, die man mit der Waage feststellen kann. Diese Veränderungen können wir am Gewebe mit bloßem Auge sehen. Was wir als Nächstes machen ist die mikroskopische – also die feingewebliche Analyse. Dort entnehmen wir von definierten Hirnregionen kleine Gewebe-stücke, arbeiten die auf, versetzen sie mit Spezialverfahren, um gewisse Strukturen am Gewebe sichtbar zu machen. Und wir untersuchen sie im Mikroskop, wo wir nochmals zwei ganz typische Veränderungen feststellen können: einmal die Alzheimer Plaques, die sogenannten A-Beta Eiweißablagerungen und zum anderen, die in den Zellen gelegenen Neurofibryllen-Bündel oder auch Tauveränderungen genannt. Das sind die klassischen diagnostischen Kriterien, die wir nachweisen können. Wichtig für das Vergesslichkeitssyndrom ist auch der Untergang von Nervenzellen – die Nervezellenstrukturen mit denen wir Gedächtnis gangbar machen, mit denen wir Speichervorgänge im Gehirn machbar machen können. Die fehlen. Dieser Verlust von Nervenzellen ist natürlich etwas, was alle Menschen mit Demenz in gleicher Form haben, ist aber etwas, dass manchmal am Gewebe gar nicht so einfach nachzuweisen ist, weil sie einen Nervenzellenverlust erst dann mit dem bloßen Auge feststellen können, wenn da 30% und mehr ist.
Können Sie anhand der Diagnostik auf den klinischen Befund des Patienten zurückführen, wie sich der Patient verhalten hat?
Es gibt definitiv grobe Muster, die man gewissen Hirnregionen zuordnen kann. Gedächtnisverlust ist etwas, was in den sogenannten Hypokampus Regionen vonstatten geht. Das sind die Strukturen, wo Gedächtnisformation vonstatten geht. Wir haben andere Demenz-Formen, wo zum Beispiel eher der frontale Bereich betroffen ist. dort, wo Persönlichkeitsstrukturen liegen. dort finden wir bei entsprechenden Hirnschwund Zeichen im frontalen Bereich. Persönlichkeitsveränderungen, die sich dann zum Beispiel beim Demenz-Patienten eben in Veränderungen der klassischen Charaktereigenschaften bis hin zu aggressiven, kriminellen Verhaltensweisen äußern. Das ist häufig etwas, das ein morphologisches Korrelat an den Untergang von frontalen Strukturen im Gehirn hat. Aber das sind ganz grobe Richtlinien und grobe Richtlinien, stimmen dann in ihrer Grobheit.
Zum Stichwort Charaktereigenschaften und Kontrollverlust innerhalb einer Persönlichkeitsstruktur bei Menschen mit Demenz: man hört immer wieder, dass sie eine gesteigerte Libido haben und damit auch sehr unkontrolliert mit umgehen. Wie lässt sich das erklären?
Ich denke es gibt alle Ausprägungen, von wahrscheinlich gesteigerte bis hin zu reduzierter Libido. Alle extremen Formen sind möglich, weil eben die uns anerzogenen und im Alltag existierenden Kontrollmechanismen verloren gehen. Das mag auch die Libido betreffen. Das sind gewisse Verhaltensweisen. das ist auch eine Aggression, weil man sie nicht mehr bremsen kann. Das ist, so kann man sagen, un- bis asoziales Verhalten, um nur mal die negativen Ausläufer zu benennen. Es ist aber auch wichtig, dass man im direkten Umgang mit dem Patienten sieht, dass sie für ihren Kontrollverlust nicht verantwortlich gemacht werden können, weil das Gehirn ihnen nicht mehr erlaubt, es nicht mehr zulässt entsprechend adäquat sozial sich zu verhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu anderen Formen des a- oder un-sozialen Verhaltens, dass kein Korrelat im Gehirn hat.
Sie haben eben negativen Ausläufe der Demenz beschrieben. Können sie auch positive Merkmale der Demenz beschreiben?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich wüsste jetzt keine, weil alles, was uns, normaler Weise, ein gesundes Gehirn erlaubt, ist doch eher positiv besetzt. Jedenfalls wenn es sich den entsprechenden Jahrzehnten und Jahrhunderten der Evolution und den entsprechenden kulturellen Wurzeln und Bildungsansätzen bedient. die Tatsache, dass man dich nicht mehr an sich, an sein Leben, an seine Angehörigen erinnern kann, ist schon mal etwas, was ich aus meiner Sicht, aus meiner Kultur kommend und mit meinem Bildungsverständnis etwas, was ich als negativ empfinden würde. es gibt ja auch stimmen, die sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man in sich autistisch isoliert wird. Ich würde es als etwas Unangenehmes empfinden, jedenfalls aus heutiger Sicht, als Außenansicht auf den Patienten, und auch die bereits geschilderten Veränderungen des Verhaltens sind eher als etwas Negatives zu interpretieren.
Ich denke, es gibt sicher Konstellationen, wo zumindest über eine gewisse Phase, temporär im Krankheitsverlauf – das sind ja auch Dinge, die sich verändern. Das ist ja kein feststehender Status quo, der irgendwo erreicht wird. Das es mal eine Phase geben mag, wo jemand mal besonders nett und freundlich ist, also das ist sicherlich denkbar. Aber sie fragen mit dem Neuropathologen den Falschen, weil wir den Patienten nicht sehen und nicht betreuen, sondern ihn eher in einem Endzustand, eher kalt kennen lernen.
Ich frage mich deshalb, weil wir ja alle eine Sorge mit uns tragen, was ist, wenn diese Sorge wegfällt? Die scheint bei einem Menschen mit Demenz auch irgendwann wegzufallen. Und wenn diese Sorge wegfällt, bleibt doch vielleicht eine Befreiung und Enthemmung, die dann auch schön sein könnte?
Absolut, da gebe ich ihnen vollkommen recht. ich glaube, es ist schwer, die Außenansicht und die Innenansicht zusammen zu bringen. In der Tat: mit seinen Alltagssorgen wünschte man sich manchmal, sich loslösen zu können und ein intensiviertes und nicht mehr rationalisiertes Dauer-Urlaubsgefühl zu haben: der Alltag ist weit weg. ich denke aber, dass, wenn man sich ganz ehrlich aus jetziger Sicht fragt, ob man das gerne möchte, würde man das wohl immer verneinen. ich glaube, es ist nichts Wünschenswertes. Wenn, dann ist es nur punktuell wünschenswert. ich vergleiche das mit einem Blick in die Vergangenheit, wo wir punktuell denken, dass früher alles besser war. das sind nur die kurzen Momente an die wir uns erinnern. Ansonsten, denke ich, sind die Gefühle und die Situationen doch eher sehr identisch gewesen. Von daher hätte ich Mühe mit einer Aussage, dass Demenz ein wünschenswerter Zustand ist. Aber es ist richtig, dass aus der Innenansicht, wenn man sich mit größtmöglicher Empathie in den Patienten hineinversetzt, dann kann es schon sein, dass der sich los gelöst für sich fühlt und für ihn das Ganze wesentlich weniger emotional schmerzhaft und belastet ist, als für die Angehörigen, für das Außen. das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil er nicht mehr das Gespür für seine eigenen Verhaltensweisen und für seine Mechanismen und für seinen Zustand hat. die schwierigste Phase im Krankheitsverlauf ist meines Erachtens auch die Übergangsphase, wo man noch die Wachphasen hat und wo man feststellt: ich bin nicht mehr in der geistigen Verfassung in der ich sein müsste. Es gibt diese Phasen, wo der Patient weiß und spürt, dass er nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass ist für den Patienten die wahrscheinlich schmerzhafteste und schwierigste Konstellation. aber in der Tat, wenn der Patient im Endstadium ist, und komplett isoliert ist, ist es wahrscheinlich nicht mehr ein Problem.
Es gibt einerseits medizinische Fakten bezüglich des Verlaufs von Demenz und andererseits gesellschaftliche Zustände. Gibt es aus ihrer Sicht als Mediziner einen kausalen Zusammenhang?
Klar ist es, dass man als Mediziner im Alltag erstmal technisch – medizinisch funktioniert, aber letztlich sieht man immer in einer Erkrankung den Gesamtkontext: mit den Angehörigen, mit allem, was dazu gehört und von daher kann man sich auch als Mediziner diesen Fragen nicht entziehen.
Würden Sie sagen, Demenz ist eine typische Krankheit dieser Zeit?
Das klingt ein wenig so, als wäre Demenz eine Bestrafungserkrankung unserer Zeit. das finde ich schwierig. Hier gibt es ganz andere Fakten: Rein epidemiologisch ist es eine offensichtliche Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, die vermutlich immer schon da war. Nämlich sie trifft immer die Älteren, 65 plus und aufwärts. wir haben sie in der Form und in dieser Quantität nie wirklich so wahrgenommen, weil wir bis vor kurzem in so einer hohen Anzahl so alt geworden sind. es gibt einen Vergleich: die Hälfte aller Menschen, die 65 und älter geworden sind, lebt heute. und wir wissen gleichzeitig, dass heute ein Drittel aller Patienten, die 80, 85 oder auch älter sind an einer Form von Demenz erkranken werden. Und wenn man das zueinander in Beziehung setzt, es extrapoliert, wäre das eine Erkrankung, die deswegen heute auftritt, weil wir eben so dramatisch älter werden, als noch vor 20 Jahren. das ist erstmal ein Faktum und ich bin der Meinung, wenn wir im römischen Reich auch schon über 80 geworden wären, dann wäre die Krankheit dort auch schon aufgetreten. Wir haben eine gewisse Vor-Veranlagung, dass ab einem gewissen Alter diese Erkrankung auftritt.
Also: es gibt keinen Neuzeit-Virus. Das ist keine übertragbare Krankheit, die plötzlich um sich greift und deswegen heute häufiger vorkommt. Das ist auch mit Zahlen aus der Epidemiologie zu beweisen.

Gespräch mit Dr. Dr. em. Reimer Gronemeyer, Soziologe
moderiert von Helena Waldmann und Dunja Funke | 2010
Den Verstand an der Garderobe abgeben>
Auszug aus dem Gespräch mit Prof. Dr. Dr. em. Reimer Gronemeyer, Autor und Soziologe, 1. Vorsitzender Aktion Demenz, Universität Gießen
Würden sie eine Demenz-Erkrankung als eine Zivilisationskrankheit im 21. Jahrhundert bezeichnen?
Wenn alte Menschen die Erfahrung machen, dass ihnen ständig ins Ohr geflüstert oder geschrien wird, dass ihr Können und ihre Lebenserfahrungen nichts mehr wert sind, kann es nicht so sehr wundern, wenn die Zahl der alten Menschen, die sich dazu entschließen, ihren Verstand an der Garderobe abzugeben, wächst. Ich sehe die Demenz auch als eine Ausdrucksform der Ohnmacht der Alten mit dieser Gesellschaft und ihren Zumutungen umzugehen. Die Demenz trifft uns in den Kern unseres Selbstverständnisses. Deswegen ist sie auch so bedrohlich. Deswegen kann man hören, dass die Leute sagen: ich will lieber sterben als dement werden, weil das nicht sowas ist wie Krebs oder Tuberkulose oder Syphilis, sondern es ist das, was uns in unserer ureigenen Existenz am meisten bedroht.
Sie kritisieren den rein medizinischen Ansatz in Bezug auf Behandlungsmethoden von Demenz-Patienten. Dabei untermauern sie Ihre Thesen mit einem pathologischen Befund der Ordensschwestern von Notre Dame.
In einem amerikanischen Kloster, wo viele ältere Nonnen lebten, wurde das Leben der dort lebenden Ordensschwestern erforscht – ihr Vergessen, ihr Erinnern etc. Nach dem Ableben wurden ihre Gehirne obduziert. Dabei stellte sich z.B. heraus, dass eine der Schwestern, die bis ins hohe Alter völlig aufgeweckt und bei klarem Verstand war, laut Obduktionsbefund in der Endstufe von Demenz hätte sein müssen. Und den umgekehrten Fall gab es auch. Was nochmals deutlicher gemacht hat, dass der enge medizinische Blick, offensichtlich etwas übersieht, was darauf verweist, dass der Verlauf von Demenz sehr viel damit zu tun hat, wie sozial verankert die Menschen sind. Es gibt ja keine Rolle rückwärts in die Zustände, die wir verloren haben, aber es ist natürlich schon die Frage, ob unsere Lebenswelt so erträglich ist, wie wir sie leben, mit allem immer stärker werdenden Anteil von Isolation und von Einsamkeit. Insofern sind die Menschen mit Demenz für uns vielleicht Träger einer Frage, die auf uns zukommen und sagen: sagt mal, was ist eigentlich mit den Lebenswelten in denen ihr euch befindet los?
Ich habe schon so manches Mal gedacht, vielleicht sind die Menschen mit Demenz sowas wie die Heiligen dieser Gesellschaft, in dem Sinne, dass sie das Leiden an einer beschleunigungsbesessenen Gesellschaft tragen, nicht als ein Akt des Willens, sondern sie kommen aus der Nachtseite dieser Gesellschaft auf uns zu und fragen uns: was habt ihr eigentlich angerichtet, dass wir so leben müssen? Wenn man das zulässt, dann werden aus bedrohlichen Figuren vielleicht auch so etwas wie unsere Zwillingsgeschwister,, die uns die Frage stellen: was ist eigentlich passiert?
Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die Menschen mit Demenz besser einbindet und gleichzeitig, wie Sie sagen, deren Botschaft an diese beschleunigte Welt berücksichtigt?
Es ist ja keine Frage mehr, ob Demenz für Deutschland und für Europa eine soziale und kulturelle Herausforderung wird. Um eine dieser Horrorzahlen zu nennen: im Jahre 2020/ 25 wird es in Europa 70 Millionen Menschen geben, die über 80 sind. Es ist keine Schwierigkeit, daraus ein Horroszenario zu basteln. Ich würde aber sagen, das Umgekehrte wäre die Herausforderung. Nämlich: vielleicht ist die Zukunft Europas nicht in erster Linie eine Frage nach den Wachstumsraten und den Börsendaten, sondern vielleicht entscheidet sich die Zukunft Europas an solchen Fragen viel mehr, wie : schafft es dieses krisengeschüttelte alternde Europa diese große Herausforderung mit Millionen Menschen mit Demenz so aufzunehmen, dass daraus ein humanes Miteinander werden kann, und dass das nicht unbedingt alles alleine mit Geld zu lösen ist. Geld ist wichtig für eine gute Pflegebetreuung. Aber in erster Linie ist klar, dass wir einen neuen Zugang zu Gemeinschaftlichkeit und Solidarität brauchen.
Es gibt ja diese fiesen Typen, die nichts anderes im Kopf haben als das Zusammenkratzen von Geld und von Karriere etc., aber das sind ja die Toten im Grunde genommen. Die Lebendigen sind immer weniger, aber es gibt die Chance, dass sie die Gesellschaft prüfen und gestalten. Und sie werden dann die Menschen mit Demenz mitnehmen.

Gespräch mit Nina de Vries, Sexualassistentin
moderiert von Detlef Rüsing | 2008
"Sex ist mehr als genitale Lust!“>
Nina de Vries erbringt sexuelle Dienstleistungen für behinderte Menschen.
Sie ist eine in der Öffentlichkeit durch Zeitungen, Funk und Fernsehen bekannte Sexualbegleiterin. Sie bietet mit weiteren speziell ausgebildeten Kolleginnen unter anderem Beratung, Massage, Zärtlichkeit und nackten Körperkontakt hauptsächlich für Menschen mit schwereren physischen und psychischen Beeinträchtigungen an. Jeder Mensch hat ein Recht auf würdevolle Sexualität, sagt de Vries.
Herausgeber der Fachzeitschrift Demenz, Detlef Rüsing, befragte sie zu ihrer Arbeit mit älteren beeinträchtigten Menschen.
Detlef Rüsing: Sehr geehrte Frau de Vries, das Thema Alter und Sexualität unterliegt einem Tabu. Warum das ist das Ihrer Meinung nach so?
Nina de Vries : Ich glaube, dass Sexualität überhaupt noch immer ein Tabuthema ist. Meiner Meinung nach sind wir in dieser Hinsicht keine aufgeklärte Gesellschaft. Wenn man sich die Gesellschaft wirklich anschaut, ist sie ziemlich grausam – nur das Zeigen von Pornografe bedeutet noch keine Aufklärung.
Aufklärung bedeutet in meiner Sicht: Jeder hat die Möglichkeit, eigene würdevolle sexuelle Erfahrungen machen zu können. Das ist ein Entwicklungsprozess, der bezüglich Sexualität Jahrhunderte lang beispielsweise von der Kirche unterbunden wurde, indem man Sex mit Sünde gleichgesetzt hat.
Überhaupt zum Thema Berührung: Berührung ist für viele etwas Beängstigendes. Es ist lediglich gesellschaftlich akzeptiert zwischen kleinen Kindern und ihren Eltern, zwischen liebenden Menschen in einer Paarbeziehung oder zwischen Menschen und Tier. Der Mensch ist ein sexuelles Wesen, ob er nun jung, alt, behindert oder nicht sichtbar behindert ist. Wir alle brauchen Berührung.
Rüsing: Sie selbst arbeiten aktiv als Sexualbegleiterin und Sexualassistentin hauptsächlich mit Menschen mit mehrfach schweren Beeinträchtigungen. Wie kann man sich diese Arbeit vorstellen?
de Vries: Meine Klienten sind Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung – angeboren oder erworben – wenige oder keine Möglichkeiten haben, ihre Sexualität zu erleben und sinnliche erotische Erfahrungen zu machen. Sie signalisieren jedoch klar durch Worte oder andere Ausdrucksformen, dass sie diese Erfahrungen wollen oder brauchen.
Es gibt Klienten, die aufgrund von Missbrauchserfahrungen ein gestörtes oder gar kein Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Sexualität haben oder auch andere, die durch einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krankheiten gezwungen sind, neue Wege zum Erleben ihrer Sexualität zu entdecken, beispielsweise wegen Orgasmus Störungen, Impotenz oder Amputationen. Aber es gibt auch viele alte Menschen, die in unserer leistungsorientierten Gesellschaft mehr oder weniger abgeschoben werden und denen Sexualität nicht selten abgesprochen wird.
Mein Angebot ist für Männer und Frauen, wird aber fast nur von Männern in Anspruch genommen. Ich biete beispielsweise Beratung, Massage, Zärtlichkeit, nackten Körperkontakt, Anleitung zur Selbstbefriedigung und Handentspannung, also Genitalmassage, an. Ich persönlich biete keinen Geschlechtsverkehr oder Oralkontakt an. Nicht, weil ich darüber ein moralisches Urteil fälle, sondern es geht da um eine persönliche Grenze.
Rüsing: Sie haben eine mehrjährige therapeutische Ausbildung durchlaufen. Was unterscheidet Ihre Arbeit von der einer Prostituierten? Braucht man eine besondere Ausbildung, um Ihre Arbeit durchzuführen?
de Vries: Sexualassistenz ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung, bei der der Mensch an erster Stelle steht und sich das Geschäft an zweiter Stelle befindet, aber es ist eine bezahlte Dienstleistung.
Das Wichtigste, was jemand für diese Tätigkeit mitbringen muss, ist eine transparente und bewusste Motivation. Herauszufinden warum ich das machen möchte, erfordert meist auch intensive Selbst- und Therapieerfahrung.
Der oder die Durchführende muss die Fähigkeit haben, mit sich selbst in Kontakt zu bleiben und zu merken, wie es ihm/ihr dabei ergeht, wenn er oder sie eine intime Begegnung für jemand anderen gestaltet. In meinen Augen hängt die Qualität der Arbeit davon ab, inwieweit ich mir auch meiner eigenen Grenzen bewusst bin und ich wie weit ich diese achte. Es geht nicht darum, jeden zu mögen und wahllos Erwartungen zu erfüllen oder darum, nur zu befriedigen. Wesentlich ist, präsent zu sein, in Kontakt zu sich selbst zu sein und so eine echte Begegnung mit ihren Höhen und Tiefen, ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erlebbar zu machen. Es geht darum, körperliche Lust und sexuelle Bedürfnisse als vollkommen menschlich und selbstverständlich wahrzunehmen.
Die Sexualität und Sinnlichkeit, über die ich hier rede, ist eine ganzheitliche, ganzkörperliche, lebendige und bewusste und nicht eine auf Geschlechtsmerkmale bezogene, mechanische Sexualität, wie man sie öfter in der sogenannten „normalen Prostitution“ aber auch in vielen
Ehebetten findet.
Ich möchte hier noch anmerken, dass es auch viele Prostituierten gibt, die ihre Arbeit gut und gerne machen.
Rüsing: Ältere Menschen in Altenheimen oder zu Hause lebend haben sexuelle Bedürfnisse. Ich weiß, dass auch Altenheime mit Ihnen arbeiten. Wie kann man sich Ihre Arbeit dort vorstellen? Wer informiert sie und sucht den Kontakt zu Ihnen?
de Vries: Zumeist sind es Heimleitungen oder Pflegedienstleitungen. Manchmal werde ich erst für einen kleinen interaktiven Vortrag über meine Arbeit engagiert. Das gibt dem leitenden Personal und Mitarbeitern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Zweifel an- und auszusprechen. Dabei werden häufig so manche Vorurteile abgebaut. Wichtig ist, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre entsteht, damit das Personal die Arbeit, wenn sie dann mit einzelnen Leuten stattfindet, auch mittragen kann. Dazu gehört: Termine machen, praktische Vorbereitung, Nachbereitung.
Rüsing: Zwischen 50 und 80 Prozent der Bewohner der stationären Altenhilfe leiden unter einer Demenzerkrankung. Pflegende berichten bisweilen von „sexuell enthemmtem Verhalten“ und Übergriffen demenzerkrankter Männer auf Bewohnerinnen der Einrichtung. Können Sie sich vorstellen, sexuelle Assistenz auch bei Demenzkranken zu leisten oder haben Sie bereits Erfahrungen damit?
de Vries: Ja, ich hatte und habe auch Klienten mit Demenzerkrankungen. Ich habe auch Klienten, die übergriffig geworden sind auf Mitbewohnerinnen. Da ist es wichtig, ganz vorsichtig und behutsam vorzugehen. Ich stelle mir persönlich so eine Desorientierung als beängstigend vor. Ich habe zum Beispiel einen demenzerkrankten Klienten, der mir jedes Mal wieder neu begegnet. Ich stelle mich jedes Mal wieder vor und erkläre ihm, was möglich ist. Das findet er dann eine gute Idee.
Es gibt auch Menschen, die sich nicht mehr verbal ausdrücken können. Ich habe meinen an Alzheimer erkrankten Vater die letzten Jahre vor seinem Tod beobachten können. Obwohl er keine Sprache mehr hatte, habe ich das Gefühl gehabt, dass er immer bis zuletzt erreichbar war für Berührungen, Herzlichkeit. Ich denke, dass man in diesem Zustand auch empfindsamer werden kann. Natürlich ist es auch so, dass viele, die jetzt alt und demenzerkrankt sind, wenige Möglichkeiten hatten, Sexualität auf eine zufriedenstellende Art und Weise zu erleben. Manche tragen auch unter Umständen tief verborgene Missbrauchserfahrungen und Traumatisierungen in sich Diese Wunden können natürlich auch sichtbar werden, weil die Selbstkontrolle durch die Demenz weniger wird. Also wichtig sind die Behutsamkeit und auch das Bewusstsein, dass Sexualität weit mehr als genitale Lust ist. Obwohl es auch wichtig ist zu respektieren, dass speziell für viele Männer einer bestimmten Generation diese ganz klar im Vordergrund steht.
Rüsing: Der Blick auf die Sexualität anderer hat immer auch mit der Person zu tun, die den Blick auf andere richtet. Was empfehlen Sie Pflegenden, die in ihrem Beruf Abwehr bis hin zu Ekel empfinden, wenn sie mit der Sexualität älterer demenzerkrankter Menschen konfrontiert werden?
de Vries: Ich bewundere viele, die in der Pflege arbeiten. Das scheint mir ein harter Job zu sein. Wichtig in aller pflegerischen Arbeit mit Menschen ist es, zu den eigenen Grenzen zu stehen, gut für sich selbst zu sorgen. Ganz schön schwer, wenn man die Umstände in viele Einrichtungen sieht.
Rüsing: Wie empfinden Sie selbst die Ihnen teils in den Medien öffentlich entgegengebrachte Verachtung für Ihre Tätigkeit und Ihre Person?
De Vries: Diese Frage überrascht mich, weil ich im Grunde genommen seit Jahren eher Respekt und Anerkennung für meine Arbeit bekomme. Manchmal hat es das gegeben, dass nach Presseauftritten Menschen anonym reagiert haben. Da lese ich ein paar Zeilen und lasse es dann sein. Aber wie gesagt, ich mache seit Jahren überwiegend die Erfahrung der Wertschätzung von außen. Sonst hätte die Arbeit auch nie so wachsen können. Ich bin keine Jeanne d´Arc!
Rüsing: Herzlichen Dank für das Gespräch.
lllll