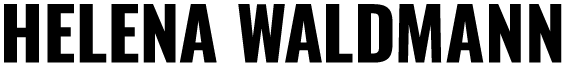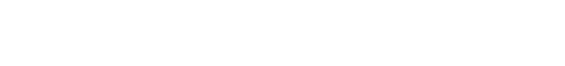Eva-Elisabeth Fischer / Tanzplattform / 2016
Helena Waldmann tanzt nicht, aber sie arbeitet mit Tänzerinnen und Tänzern. Helena Waldmann hat niemals Choreografieren gelernt, aber sie choreografiert. Das Studium der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen legte die subversive Lunte im Kopf. An der Uni arbeitete sie unter anderen mit Heiner Müller, dem Versprachlicher existenzieller Aussichtslosigkeit unter den immer falschen politischen Verhältnissen, und mit George Tabori, dem Magier des Method Acting. Auf der Bühne schuf sie, eine Verkörperlicherin sprechender Bilder, von Anfang an ihr eigenes Zwischenreich. Sie wird fündig in Brasilien, dem Iran oder Bangladesch. In der Ferne sammelt sie Material, legt den Finger in politisch-soziale Wunden und schlägt, stets Widerspruch provozierend, unvermittelt den (ideologischen) Haken. Das vermittelt noch nicht, was sie künstlerisch denkt und tut, zumal man keine Künstlerinnen und Künstler benennen könnte, die ihr Vorbild gewesen wären oder die sie nachahmten. Helena Waldmann schöpft aus dem, was sie erlebt und kleidet das dann metaphorisch ein in eine makellose Bild-Ästhetik. Frauen, die in der Verschleierung ihre Behausung finden? Das geht, bewiesen in Letters from Tentland (2005). Seliges Vergessen durch Alzheimer? revolver besorgen (2010) wendet den Todeswunsch des eigenen Vaters ab. Der Sweatshop als Ort weiblicher Emanzipation? Kathak stampfende Füße im Rhythmus ratternder Nähmaschinen hämmern einem das Widersinnige ein in Waldmanns jüngstem Coup Made in Bangladesh (2014). So dringlich, bis man’s glaubt.
Dorion Weickmann / Tanz / März 2012
Frei von institutionellen Navigationssystemen bleibt sie hart auf Kurs. Die Tanzregisseurin sorgt für politisch Brisantes, aktuell in «revolver besorgen» und ihrem «GlückStück».
Ein altgedienter Portier am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden könnte sich noch an dieses sonderbare Mädchen erinnern. Es war in den frühen achtziger Jahren, als die meisten Abiturientinnen Knattermofa fuhren oder sich hinter schnieke Popper-Knaben aufs Moped zwängten. An Motorrädern herumzuschrauben war eindeutig boys’ business, weshalb die Zahl weiblicher Teenies, die sich sogar geländegängige Modelle unter den Hintern klemmten, bundesweit im Promillebereich gelegen haben dürfte. Helena Waldmann gehörte zu dieser Spezies. Jeden Abend heizte sie mit ihrer Enduro durch die blank gewienerte Kurstadt zum Theater. Statt bürgerliche Weihespiele zu besichtigen, nahm die Gymnasiastin mit der bescheidenen Studiobühne vorlieb. Was sie binnen ein, zwei Stunden an Bildern auflas, wurde am nächsten Morgen, Punkt halb acht, im Französisch-Leistungskurs den Mitschülern präsentiert. Nie wäre ihr eingefallen, jemanden auf diese Theatertrips mitzunehmen. Helena Waldmann war gut unterwegs, mit sich allein da draußen in der Welt. So ist es immer noch.
Aufruhr in der Komfortzone
«Ein Kollektiv ist nicht mein Ding.» Sagt die Tanzregisseurin, die seit 20 Jahren nichts anderes tut, als eben: mit Kollektiven zu arbeiten. Aber jedes Mal sucht sie eine neue Besetzung, jedes Mal steckt eine andere Idee dahinter, und jedes Mal kommt eine Überraschung dabei heraus. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss um Helena Waldmann einen Bogen machen: Soll man sie in den Tanz, ins Sprechtheater, in die Performance stecken? Für Festivaldirektoren, Subventionsentscheider und Programmmacher ist ihr Mäandern zwischen den Welten reichlich unbequem. Genauso darf Helena Waldmanns Publikum nie mit einem Sitz in der Komfortzone rechnen, sondern muss sich auf unablässige Totalrevirements einlassen – von Ansichten, Sehgewohnheiten und liebgewordenen (Vor-)Urteilen im Angesicht umstrittener Gesellschaftsreviere.
Allein im letzten Jahrzehnt hat die Generalistin ihre Zuschauer durch fünf disparate Soziotope gelotst: Politik («Letters from Tentland», 2005; «Return to Sender», 2006), orgiastische Sause («feierabend! – das gegengift! –», 2008), clash of cultures («BurkaBondage», 2009), Demenz («revolver besorgen», 2010) und der vermaledeiten pursuit of happiness («GlückStück», 2011), der wir Zivilisationsschafe wahnhaft verfallen sind. Die Frau findet Themenmosaike und Erfahrungsminerale wie andere Leute Muscheln am Strand.
Den Tanz behauen
So ist es, seit sie denken kann. Zuerst entzündeten die Wiesbadener Studiobühnen-Feuersteine Helena Waldmanns Theaterleidenschaft – «Jede Aufführung gab mir dieses unvergleichliche Kribbeln im Bauch» –, dann, beim Studium der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen, stießen akademische Granitblöcke nebst empirischem Feinstaub hinzu – «Als Schauspielerin war ich untauglich, weil zu schüchtern» –, nebenher drückte ihr jemand ein paar Rohdiamanten in die Hand – «Eine Gastprofessorin meinte: ‹Du gehörst in den Tanz!›» –, danach nahm sie ein paar Stadttheater-Regie-Quarzite aus Bochum mit – «Schöne Zeit, aber dauerhaft ist das System nichts für mich» –, und schließlich ging sie daran, das in Zickzackmanier angehäufte Material eigenmächtig zu behauen. «Zerlegen, verstehen und das Theater neu zusammensetzen, das habe ich sieben Jahre lang am Frankfurter Mousonturm geübt.» Mit Produktionen, die darauf zielten, den Zuschauerblick prismatisch aufzufächern oder ungebremst gegen die vierte Wand donnern zu lassen («vodka konkav», 1997).
Irgendwann landete sie endgültig im Tanz. «Weil Tänzer sich viel eher auf etwas einlassen, während Schauspieler millionenmal nach dem Warum fragen», sagt Helena Waldmann mit sonorem Pragmatismus. Mal hierhin, mal dorthin wandert die Lesebrille durch ihre Finger. Es ist die einzige Ablenkung, die sie sich gestattet. Egal, ob Winzlingsköter um ihre Stuhlbeine wedeln oder Berlin-Mitte-Muttis mit ihren Minis durch die Cafétür rein und raus gondeln – wenn sie arbeitet (und so ein Gespräch ist Arbeit), stört nichts den Gang ihrer Gedanken. Zurück also zur Warum-Frage, die kein noch so ausgeklügeltes Storyboard beantworten kann, sondern nur gemeinsame Schleifarbeit, vulgo Probenprozess genannt. Was den betrifft, räumt sie freimütig ein: «Ich reibe mich gern an allem, was die Leute mir bringen.» Und zwar am liebsten, nachdem sie allen Beteiligten, also auch sich selbst, den branchenüblichen «Theaterkoffer» abgeluchst hat. Mit einer Assemblage bewährter Kabinettstückchen kommt bei Helena Waldmann keiner durch, und bei der Suche nach attraktiven neuen Bewegungskostümen ist sie ausgesprochen wählerisch. Das artet zwar fast immer in Strapaze aus, aber diesen Preis kalkuliert sie offenbar ein und zahlt ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Dass ihr Anspruch jede Serienfabrikation ausschließt, ist ebenso klar wie beabsichtigt: «Qualität hat Vorrang, ich fertige keine Produkte und will selbst keine Marke sein.»
Jenseits der Repetierfalle
Wer dennoch unbedingt eine Schublade braucht, sortiert sie am besten unter die Gesamtkunstwerker. Dass Helena Waldmann ursprünglich Bühnenbilder entwerfen wollte, lässt sich ihren Theaterallegorien immer noch unverwandt ablesen. Selbst wenn sie Ausstatter beschäftigt, sind die Dekors genauso streng filetiert wie alle anderen Inszenierungszutaten. Getreu der Faustregel: «Das Fett wegschneiden, bis nur noch die Essenz auf dem Tablett liegt.» Deshalb stehlen Sprache, Tanz, Multimedia und Musik einander hier nie die Show, sondern steuern fein dosiert ihre unverwechselbare Note zum Gelingen bei.
Das jüngst präsentierte «GlückStück» liefert dafür ein Paradebeispiel. Regelmäßig getaktet, verkünden weiße Lettern auf schwarzem Grund, in jeweils zehn Minuten komme das Glück, die Freiheit, der Tod. Unterdessen trotteln, trippeln und tirilieren vier Performer durch eine güldene Raffgardinen-Arena, bis sich – dank famoser Lichtregie – die Lamettagirlanden in düstere Trauerflore verwandeln. Die mopsfidelen Herrschaften hampeln weiter dem Glück hinterher, dessen Rockschoß sie freilich niemals zu fassen kriegen. Immer grotesker reißen sie ihre Ensor-Fratzen auf, um schließlich in den Abgrund des Stillstands zu torkeln. Wer den Augenblick verpasst, den bestraft das Leben – mit Erstarrung, Herzenskälte, Anästhesie. Mit Tod bei lebendigem Leib.
Umgekehrt begreifen die meisten Zeitgenossen das demente Ausbleichen aller Erinnerung als Mausoleum, in dem bemitleidenswerte Demenzopfer hoffnungslos dahinvegetieren. Nicht so Helena Waldmann. Acht Jahre lang hat sie ihren Vater in den schleichenden Sozial-Knockout begleitet und dabei festgestellt, dass ihre eigenen Annahmen Kokolores waren: «Wenn man Dementen wie ein Improvisationskünstler begegnet und die vertrauten Spielregeln über den Haufen wirft, verliert vieles seinen Schrecken.» Aus diesem schicksalhaften Findling wurde «revolver besorgen» mit der fabelhaften Brit Rodemund, deren ballettöse Reminiszenzen wie Irrlichter des Unbewussten aufflackern und verlöschen. Im Tanz ist «revolver besorgen» ein absolutes Unikat, vermutlich firmiert schon das Sujet in der Szene als Ausschlusskriterium. Aber wo immer das Stück gastiert, spüren die Zuschauer, dass diese 60 Minuten wie ein Brennglas unsere Ängste vor jenem Alters-GAU bündeln, der prognostisch immer weitere Kreise zieht.
Helena Waldmann hat einen siebten Sinn für derart ungemütliche Themen und scheut auch die deutliche Ansprache nicht. Dennoch liegt ihr daran, die Semantik ihrer Bewegungssätze so in der Schwebe zu halten, dass das Publikum selbst entscheidet, was es hören will, kann, muss – und was nicht. Statt «Tanz-Tanz» zu machen, will sie «mit dem Körper erzählen», aber den schmalen Grat zwischen ästhetischem Aus- und plattem Abdruck reiner Gedankenstanzen hat sie dabei genauso im Blick wie die latente Wiederholungsgefahr. Wo immer die Repetierfalle auftaucht, ändert sie den Kurs. Als ihr nach den Iran-Paraphrasen «Letters from Tentland» und «Return to Sender» das Etikett der Krisengebietschoreografin drohte, suchte sie das Weite – und enterte die «Feierabend»-Kommandobrücke, verführte das Publikum zum Feiern und erklärte den Tanz aus dem Willen zum Fest. Mehr Gegensatz geht nicht.
Kurs zum Glück
Solche Kurswechsel haben freilich nichts mit strategischen Schaltungen zu tun. Vielmehr liefern meist zufällige Fundstücke den Anstoß, aufgesammelt irgendwo rund um den Globus. Oft genug reist Helena Waldmann mit ihren Arbeiten in die Ferne, begegnet anderen Kulturen, fremden Menschen. Dabei empfindet sie sich eigentlich als «echte Nomadin – ich muss immer weiterziehen, zum nächsten Feld, ins nächste Land, zum nächsten Projekt, nur die Herde bleibt zurück!» Wer so neugierig ist, der steigt gewohnheitsmäßig mit leichtem Gepäck in den Flieger. Im Waldmann-Köfferchen muss nur Platz genug sein für das eine oder andere Artefakt, das daheim ihre Fantasie beflügelt, wenn draußen die bleigraue Berliner Winterdepression mal wieder kein Ende nehmen will.
Mobilität ist Helena Waldmanns größtes Vergnügen, obwohl die Enduro längst das Zeitliche gesegnet und anderen Fetischen Platz gemacht hat. Dem Trampolin unterm Küchenlüster beispielsweise oder einem weinroten Uralt-Cabrio, dessen Dach allmählich vermoost und damit zum objet d’art mutiert. Und dann gibt es da noch ein Ex-DDR-Zollboot – «13 Meter lang, 13 Meter nichts als Holz». Das Schiff zu erhalten, das bedeutet alljährlich eine Riesenplackerei.
Aber der Lohn ist pures Glück: An einem heißen Sommertag irgendwo weit draußen den Anker zu werfen, als unerreichbare Insel über die Wellen zu gleiten und ab und zu vom Bug aus ins Wasser zu hechten, so sieht Helena Waldmanns Vorstellung vom Paradies auf Erden aus. Manchmal dürfen Freunde den nautischen Garten Eden mit ihr teilen. Ansonsten hält sie es ebenso strikt wie stabil mit dem sammelwütigen Studiobühnen-Gast von einst: Ergebnisse und Erfahrungen werden bereitwillig geteilt, aber das empirische Geschäft an sich erledigt sie am besten als «lonesome rider».
Arnd Wesemann / 2005
Die Künstlerin Helena Waldmann und die Theaterapparate
Alte Apparate
Helena Waldmann findet nicht den richtigen Abstand. Mal bewegen sich die Tänzerinnen so nah vor den Gesichtern des Publikums, dass sie unmöglich ganz gesehen werden können. Dann wieder vernagelt sie komplett die vierte Wand der Guckkastenbühne, nur ein Spielgelsystem über den Köpfen der Betrachter zeigt ihnen das Dahinter. Oder sie steckt die Darsteller in Zelte, keiner weiß, wer sich wo verbirgt. Der Theaterapparat verlangt immer einen bestimmten Abstand, um seine Wirkung aus der Zentralperspektive zu entfalten. Dieser Apparat weckt bei Helena Waldmann Misstrauen, suspekt sind ihr seine Herrschaftsarchitektur, Tradition und das Primat des Textes. Sie bekämpft den alten Apparat mit seinen eigenen Mitteln, indem sie ständig die Perspektiven verschiebt. Manchmal liegt der Zuschauer auf dem Rücken, und über seinem Kopf wird getanzt. Aber sie ist deshalb weder im eigentlichen Sinne Choreografin, wenn das bedeutet, Tanztechniken am Körper zu erarbeiten und ein Werk aus Schritten und Bewegungen zu schaffen. Noch will sie Regisseurin sein, wenn das die Arbeit mit Schauspielern an einem Text meint. Wenn viele Choreografen und Regisseuren sich entweder im Apparat einrichten, oder sich ganz abwenden, dann baut Waldmann ihn lieber um und wendet ihn gegen sich selbst, und sucht ihn immer dort heim, wo die Maschine ihre Grenzen hat: Sie sieht sich den Apparat von allen Seiten an, indem sie keine auslässt. Sie dringt an die Körpergrenzen der Darsteller und Zuschauer vor, jenseits der glatten Oberfläche der Darstellung. Immer verrückt sie Körper und Raum, dass die Position des Zuschauers, und mit ihr seine Selbstwahrnehmung in Frage gestellt wird. Schon während des Studiums der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen stellt sich Waldmann diese Fragen, und gleich nach dem Studium erfuhr sie bei Frank-Patrick Steckel am Schauspielhaus Bochum, wie in dessen revolutionärem Anspruch in Inszenierungen wie «Germania Tod in Berlin» oder «Timon von Athen» der Text, dem das Politische zu entlocken war, die Körper grotesk instrumentalisierte. Beide, Text und Akteur, rangen immer nur um Luft. Der große Choreograf Gerhard Bohner half; George Tabori arbeitete hier, um die Widerstände von Text und Körper abzumildern, sie zu umgehen oder aufzulösen. Helena Waldmanns Lehrzeit bei George Tabori schon während ihres Studiums («Glückliche Tage», «Warten auf Godot» in München) nährte den Verdacht, dass sich die Apparate nur selbst konstruierten. Sie spürte, wie die Schauspiel-Maschine, die Ansprüche der Bühnentechnik, der Dramaturgien, der Gewerkschaften sich gegenseitig so fest im Griff hielten, sich umklammerten und erdrückten, dass dies auch dem Publikum unmöglich entgehen konnte. Die gemeinte Freiheit wurde in den Händen der Apparate einfach erwürgt.
Neue Apparate erfinden
Nach dem Durchgang durch die Schule der großen Lehrer (Bohner, Steckel, Tabori, auch Adolf Dresen, Heiner Müller) fand Helena Waldmann bei einer amerikanischen Choreografin ihr erstes Sprungbrett, bei Molly Davies. Sie sagte: «Sei frei». Ein Regenschirm im verregneten Paris. Ein billiges Hotel. Helena Waldmann fragte sich: Muss die Bühne vorn sein? Muss der Schauspieler sprechen? Muss das Publikum den Tänzer sehen? Kann nicht mal das Licht die Hauptrolle spielen? Sie las Marguerite Duras‘ «Die Krankheit Tod». Wer ist der Mann, der bei Duras nicht mehr begehren kann? Ist es nicht das Publikum, wenn es mit der Maschine Theater konfrontiert wird? Gibt es ein Theater für dreißig Menschen, die am liebsten in genau dem Bett liegen, in dem bei Duras die Frau liegt? Wer ist diese Frau? Warum bin ich unfähig, Theater zu begehren? «Die Krankheit Tod» (1993): Eine nackte Frau bewegt sich über den liegenden Zuschauern hinweg, kaum mehr als eine Armlänge entfernt. Der Text kommt wie aus dem Kopf. Die Spuren der Tänzerin sind ein Farbspiel, ein Tanz mit sich verselbstständigenden Materialien. Kaum ein Stück von ihr wurde so oft gespielt, kaum je lag das Publikum so faszinierend nah unter einer sich dem Zugriff entziehenden schönen Frau. Das machte Helena Waldmann auf einen Schlag bekannt. Das Folgestück «face…à» steigerte den Entzug. Wieder ein Text von Marguerite Duras: «Der Mann im Flur». Im Flur stand Armin Dallapiccola, in schmalen Lichtstraßen tanzte die Tänzerin und Choreografin Anna Huber. Ein ganzes Theater wurde geräumt (das damals sie produzierende Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt/Main), um das Publikum an den Stirnseiten der Bühnenfläche unter ein Spiegelsystem zu legen. Dieses System verdrehte den Blick um 45 Grad, so dass die beiden buchstäblich auf den Köpfen des Publikums tanzten. Das Gehirn gewöhnte sich an die neue Perspektive des umgelenkten Blicks, nur der Körper des Zuschauers verwirrte sich, verlor die Orientierung, aber er lag unter Spiegeln vor einer präzisen Choreografie, sicher in seinem Rausch. Seitdem ist Helena Waldmann bei den Choreografen zu Hause. Was nie ihre Absicht war. Ihre Absicht ist, das Theater auf den Kopf zu stellen. Den Text als Anleitung für neue Apparate zu verstehen. Nicht der Körper bannt, sagt sie, der Tanzende wird durch den Apparat Bühne gebannt.
Optische Apparate
Ihr internationaler Erfolg «vodka konkav» gründete sich auf ihrer fulminanten Kritik der Guckkastenbühne, die ihren Zauber aus der so genannten «Vierten Wand» bezieht, durch das vorgebliche Ignorieren des Publikums. Diese Wand ließ Helena Waldmann vollständig verbrettern. Nur ein Oberlicht gab durch reflektierende Fenster in der Bühnendecke den umgelenkten Blick frei auf die eigentliche Bühne. Die in Fetzen gegangene Geschichte des Alkoholikers in Venedikt Jerofejevs Roman «Moskva-Petushki» wirkte als Folie für einen Tanz der Zwillinge Giuseppe und Michele de Filippis, die sich mit den Videoprojektionen der Künstlerin Anna Saup und dem Lichtdesign von Herbert Cybulska zu einer Einheit verbanden, angetrieben von der Dub-Musik von Tricky Chris. Während Helena Waldmann in einem früheren Stück, «Circuit», den Körper mit separat agierenden Elementen Licht, Musik, Video und Gesang buchstäblich von allen vier Ecken her beschoss, um eine mögliche Gleichwertigkeit dieser Theatermittel zu erzielen, verschmolzen in «vodka konkav» alle Quellen des Theaters, auch die Bühne selbst, zu einer visuellen und akustischen Vision. Die Tänzer wurden zum Bild, die architektonische Bühne wurde durch das Spiegelsystem zum optischen Instrument und niemand war in der Lage zu sagen, wieviel Menschen auf der Bühne tanzten. Bis zu zehn Mal vervielfältigten sich die Zwillinge in den leicht gegeneinander verschobenen Fenstern im Oberlicht. Bühnenillusion, wörtlich genommen. Sie trennte den «Apparat» Theater von den Tänzern (schuf so einen «Apparat der Blicke», wie es Helena Waldmann nannte), als ein Theater, das nicht mehr auf die Tänzer starrt, sondern die Tänzer hinter der Vierten Wand und hinter den Spiegeln (buchstäblich bei ihrem Stück «CheshireCat» nach Lewis Caroll) befreite von reiner Vordergründigkeit und vermeintlicher Nähe, Echtheit und Fleischlichkeit. Gerade die Distanz, die der Apparat optisch erzeugte, produzierte Nähe, ohne den herkömmlichen Trick der Identifikation. Der gleichwertige Einschluss aller Elemente des Theaters, die Auflösung der strikten Hierarchie, die im Theater sonst alles dem Text unterwirft, und im Tanz alles dem Körper, wich hier einer nicht mehr hierarchischen Erscheinung von Theater. Das Theater wurde flächig, in «glücksjohnny» sogar völlig plan. Der Tänzer und sein Schatten verschmolzen hinter der Leinwand zu einer Moritat nach Brecht. Fast wie im Kino kurvte der Blick auf der Oberfläche des Theaters. Es war Zeit, neue Dimensionen zu erobern.
Hinter dem Apparat, unter die Haut
Helena Waldmann ging nach Berlin und brachte drei asiatische Tänzerinnen auf einen Laufsteg der Berliner Festspiele. Wie an einem langen Tisch saß das Publikum in unmittelbarer Nähe zu den Tänzerinnen, die ihre Haut (von Alba d’Urbano) auf ihrem Kleid trugen. Die Tänzerinnen in der Intimität des «nackten» Kostüms wurden, zentimeternah, endlos fremd. Nicht an der Tänzerin, an ihrer künstlichen Haut brach sich der Blick des Zuschauers. Der Apparat Körper begann Helena Waldmann mehr und mehr zu interessieren. Dieses Instrument Körper, das da tanzen soll, befand sich in einer ähnlichen Zwickmühle, wie das Theater auch. Der Körper des Tänzers ist abgerichtet zur audition, zur Improvisation, zur Disziplin, zur Höchstleistung, zur Schönheit und zur Oberfläche. Als Theaterkunst festgelegt, kann der Tanz nur Haut zeigen. Tanz und Theater ignorieren den Körper in allen Aspekten, die seiner Oberfläche widersprechen: dass die Haut fühlt, dass sie lebendig ist, dass die Haut ein Nährboden ist, der Haare hervorbringt. Auch dem Theater wächst das Horn aus, eben der Apparat. In «Waschen-Schneiden-Fönen» und «Headhunters» hat sie das deutlich gemacht. Sie wollte das Virtuelle, Sinnliche, Intime unterhalb der Haut des Körpers, an seinen haarigen Wurzeln, gegen den Tanz der bloßen Oberfläche des Apparats ins Feld führen. Aber es scheint das Diktat des Theaters und des Tanzes, ein Augen- und Ohrenmedium sein zu wollen. Es will die Biologie dessen, was das Theater präsentiert, den Körper und sein Inneres, einfach übersehen. Wo immer Helena Waldmann unter die Oberfläche vordrang, zum Tanzenden, der sich bisher in ihrem Werk hinter der Wand, hinter einer Folie befand, um nun noch unterhalb seiner Haut zu gelangen, immer überschritt sie dabei die Bühne, ging buchstäblich hinter die Bühne, und traf die Ob-scene, das Obszöne. Wo immer sie diese Recherche noch so sehr ins Kulinarische wendete – im Stadttheater Luzern konnte sich das Publikum während eines Stücks professionell die Haare schneiden lassen – stoppte sie ein merkwürdiges Gesetz, das wie beim Friseur den kritischen Blick in den Spiegel bevorzugt, statt sich den Kopf kraulen zu lassen. Dabei ging es ihr darum, Oberflächen zu durchbrechen, hinter die Spiegel zu gelangen und das Obszöne des Körpers freizulegen, eben das, was seine Techniken zum Verschwinden bringt.
Die Apparate der Politik
Wie eminent politisch diese Wendung ins Kulinarische und die Suche nach der vom Theater ausgesparten Sinnlichkeit ist, zeigt sich, als Helena Waldmann ihr Publikum zu einem «kannibalischen» Gelage einlud. «Gelage für Langschweine» (2000) im Podewil, eine Episode aus der Odyssee. Die Zuschauer werden verköstigt und müssen dabei ansehen, wie andere vom Mahl ausgeschlossen bleiben, die Sans Papiers. Politik geht bei Helena Waldmann durch den Magen. Ist der Apparat Theater ein sozialer Ort, wie er dies von sich behauptet? Der Ort, der die Gesellschaft eint, in dem sie Fragen diskutiert? Wird nicht im Theater geschwiegen und schließlich nur gejubelt, wie unter einem Regime? Ist das Thema der Gastfreundschaft, der Freundlichkeit, nicht selbst eine politische Kategorie, wie sie auch in «Letters from Tentland» die Frauen aus dem Publikum zur Teezeremonie hinter die Bühne einlädt, um das Theater einen offenen, freien Ort werden zu lassen. Theater macht, auch das ist genuin politisch, immer den Entzug des Realen spürbar. So geht es auch in «Letters from Tentland» nicht darum, die Realität der Frauen im Iran zu dokumentieren, dem Land der Schleier, der Wände, der Verhüllung. Sondern genau erst dieses Verbergen lässt das Verlangen nach Realität spürbar werden. Die Zeltwand zeigt, indem sie verhüllt: im Iran ist es die Frau. Ihr Tschador ist auf Farsi so homonym für Zelt, dass die Frau unter dem Zeltkleid ihre eigene Realität verbergen kann und damit dem Innen eine (un-)heimliche Macht vermittelt. Den Zensurapparat im Iran, der den Frauen das Singen und Tanzen auf der Bühne verbietet und ihnen die islamische Kleiderordnung zwingend vorschreibt, gerät durch die Übererfüllung des Reglements aus der Fassung: Auf einmal ist das Zelt die Übertretung. Durch Mut und Frechheit gegenüber der Zensur konnte sie den Apparat Theater tatsächlich entkleiden, indem sie die Spielerinnen unkenntlich machte. Hier ist es wieder die Verschleierung, die Oberfläche selbst, um nicht zu sagen: die Scham der Bühne und der Tänzer, die dem Theater die Freiheit wiedergibt, damit es nicht länger als kontrollierender Apparat über dem Zuschauer thront. Was immer der Zuschauer in den sieben Zelten erkennen wollen (die Unterdrückung der Frau, die Scham, die Gastfreundlichkeit, ein Flüchtlingsdrama, eine feministische Komödie hinter Schleiern): Unvermutet ist «Letters From Tentland» ein Stück gerade nicht nur über die Freiheit der Frauen, sondern vor allem ein Stück über die Freiheit des Theaters. «Es gibt kein Recht, alles zu sehen», sagt Helena Waldmann. Erst im Unterdrücken des Sichtbaren kann die Realität selbst auf die Bühne zurückkehren, eben weil ein gewaltiger schützender Schleier über sie gestülpt wurde. Es ist der Schleier, der das Reale spürbar macht. Das hinter der Oberfläche Verborgene braucht, vor allem, eine Oberfläche.